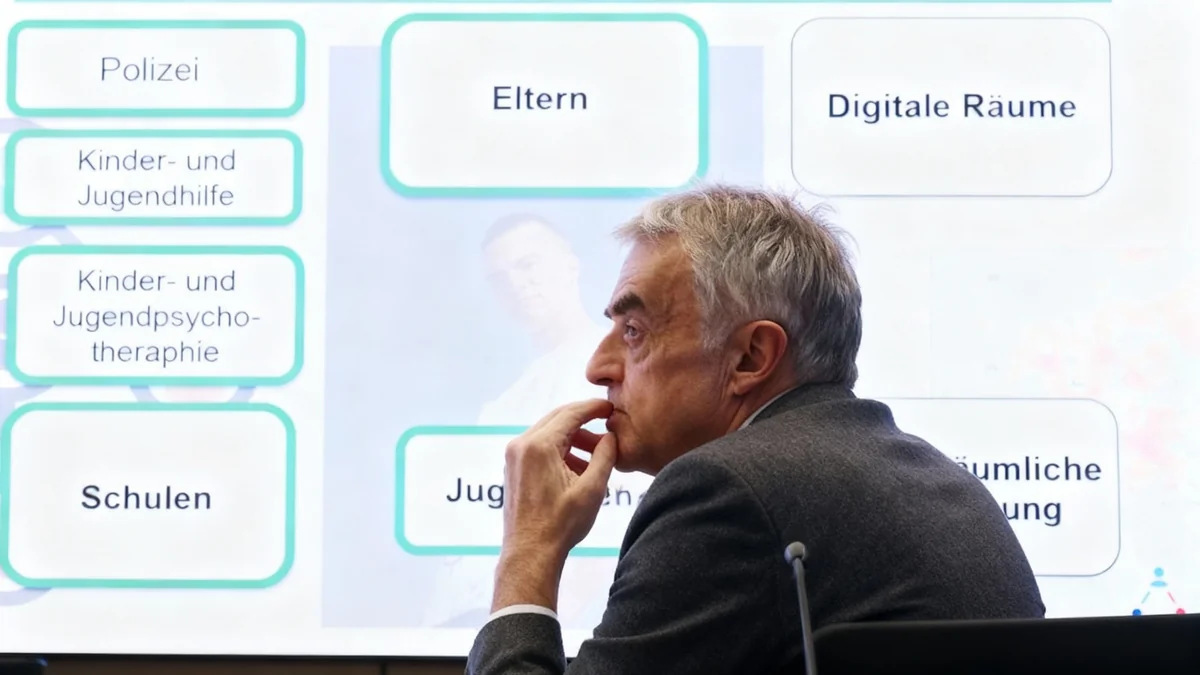Eine umfassende Studie der Universität zu Köln liefert beunruhigende Einblicke in die Zunahme der Kinder- und Jugendkriminalität in Nordrhein-Westfalen. Forscher identifizierten gestiegene psychische Belastungen, eine abnehmende Selbstkontrolle und veränderte Moralvorstellungen als zentrale Ursachen für die Entwicklung.
Die Wissenschaftler unter der Leitung von Professor Clemens Kroneberg analysierten nicht nur offizielle Kriminalstatistiken, sondern führten auch eine breit angelegte Befragung unter Schülern durch, um ein vollständigeres Bild der Lage zu erhalten.
Wichtige Erkenntnisse
- Psychische Belastungen bei Schülern, insbesondere bei Mädchen, haben stark zugenommen.
- Die Selbstkontrolle und die Furcht vor Strafen haben bei Jugendlichen nachgelassen.
- Gewalterfahrungen im Elternhaus zeigen einen klaren Zusammenhang mit der Straffälligkeit von Kindern.
- Das Unrechtsbewusstsein bei kleineren Delikten wie Schulschwänzen oder Vandalismus ist deutlich gesunken.
- Die Zahl der unentdeckten Straftaten, das sogenannte Dunkelfeld, ist laut der Studie weitaus höher als offizielle Zahlen vermuten lassen.
Psychische Gesundheit als zentraler Faktor
Eines der alarmierendsten Ergebnisse der Studie ist die deutliche Zunahme psychischer Probleme bei den befragten Jugendlichen. Die Forscher stellten fest, dass insbesondere Mädchen stark betroffen sind. Fast die Hälfte der befragten Schülerinnen klagte über Symptome wie Angst und Depression.
Diese psychische Belastung steht in direktem Zusammenhang mit einer nachlassenden Selbstkontrolle. Jugendliche, die unter Stress stehen, neigen eher zu impulsivem und delinquentem Verhalten. Die Studie zeigt, dass die Straffälligkeit von Mädchen stärker angestiegen ist als die von Jungen, obwohl sie insgesamt seltener straffällig werden.
Die Wissenschaftler sehen auch eine Verbindung zwischen einem hohen Konsum von sozialen Medien, dem Verlust von Selbstkontrolle und der Neigung zu Straftaten. Die ständige Konfrontation mit idealisierten Lebenswelten und sozialem Druck könnte die psychische Anfälligkeit weiter erhöhen.
Veränderte Werte und schwindender Respekt
Die Untersuchung offenbart auch einen Wandel in den moralischen Standards der Jugendlichen. Während schwere Gewalttaten nach wie vor stark abgelehnt werden, hat sich die Einstellung gegenüber kleineren Vergehen in den letzten Jahren deutlich gelockert.
Das Schwänzen des Unterrichts, das Stehlen eines Stiftes oder kleinere Sachbeschädigungen werden von immer weniger Schülern als falsch empfunden. Dieser Trend deutet auf ein gesunkenes Unrechtsbewusstsein im Alltag hin.
Moral im Wandel: Zahlen im Vergleich
- Schule schwänzen: Im Jahr 2015 empfanden noch 80 Prozent der Schüler dies als verwerflich. In der aktuellen Befragung waren es nur noch knapp 60 Prozent.
- Respekt an der Schule: Der Aussage, dass Lehrer und Schüler sich gegenseitig respektieren, stimmten 2015 noch 35 Prozent zu. Dieser Wert sank auf nur noch 20 Prozent.
- Konsequenzen bei Gewalt: Nur noch 39 Prozent der Schüler glauben, dass Lehrer bei einer Prügelei auf dem Schulhof einschreiten, verglichen mit 68 Prozent im Jahr 2015.
Diese Zahlen spiegeln ein schwindendes Vertrauen in Autoritäten und schulische Strukturen wider. Die Jugendlichen haben weniger Furcht vor Entdeckung und den Konsequenzen ihres Handelns, was die Hemmschwelle für Regelverstöße senkt.
Gewalt im Elternhaus und die Folgen
Die Studie legt nahe, dass auch das familiäre Umfeld eine entscheidende Rolle spielt. Die befragten Kinder und Jugendlichen gaben häufiger als noch 2015 an, im vergangenen Jahr Opfer von Gewalt durch ihre Eltern geworden zu sein.
Frühere wissenschaftliche Arbeiten belegen einen klaren Zusammenhang: Kinder, die selbst Gewalt erfahren, neigen statistisch gesehen häufiger dazu, selbst gewalttätig zu werden. Diese Erfahrungen können ein Kreislauf der Gewalt in Gang setzen, der sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzt.
Die Zunahme von gemeldeten Gewalttaten durch Intensivtäter, insbesondere bei Mädchen und nichtdeutschen Jugendlichen, könnte ebenfalls mit diesen tieferliegenden sozialen und familiären Problemen zusammenhängen.
Das Dunkelfeld der Kriminalität
Ein zentraler Bestandteil der Kölner Untersuchung war die sogenannte Dunkelfeldstudie. Dafür wurden 3.800 Schüler der siebten bis neunten Klasse an 27 Schulen in drei NRW-Städten anonym befragt. Diese Methode soll Straftaten erfassen, die nie zur Anzeige gebracht oder von der Polizei entdeckt werden.
Hellfeld vs. Dunkelfeld
Als „Hellfeld“ bezeichnet man alle Straftaten, die der Polizei bekannt werden (z.B. durch Anzeigen). Das „Dunkelfeld“ umfasst alle Taten, die nicht in der offiziellen Statistik auftauchen. Dunkelfeldstudien sind wichtig, um das wahre Ausmaß von Kriminalität zu verstehen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die offizielle Kriminalitätsstatistik ein unvollständiges Bild zeichnet. Insbesondere bei Eigentumsdelikten wie Ladendiebstahl ergab die Befragung einen deutlichen Anstieg, während die offiziellen Zahlen eher stagnieren oder sogar rückläufig sind. Die Forscher schlussfolgern, dass viele dieser Taten schlicht unentdeckt bleiben.
Auch bei Gewaltdelikten gibt es eine Diskrepanz: Laut der Befragung sind Schüler in der 7. Klasse gewalttätiger als in der 9. Klasse. In der offiziellen Statistik ist es umgekehrt. Eine mögliche Erklärung ist, dass Gewalttaten von jüngeren, strafunmündigen Kindern seltener zur Anzeige gebracht werden.
Trotz der besorgniserregenden langfristigen Entwicklung gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Im vergangenen Jahr war die Jugendkriminalität laut Statistik erstmals seit Längerem wieder leicht rückläufig.