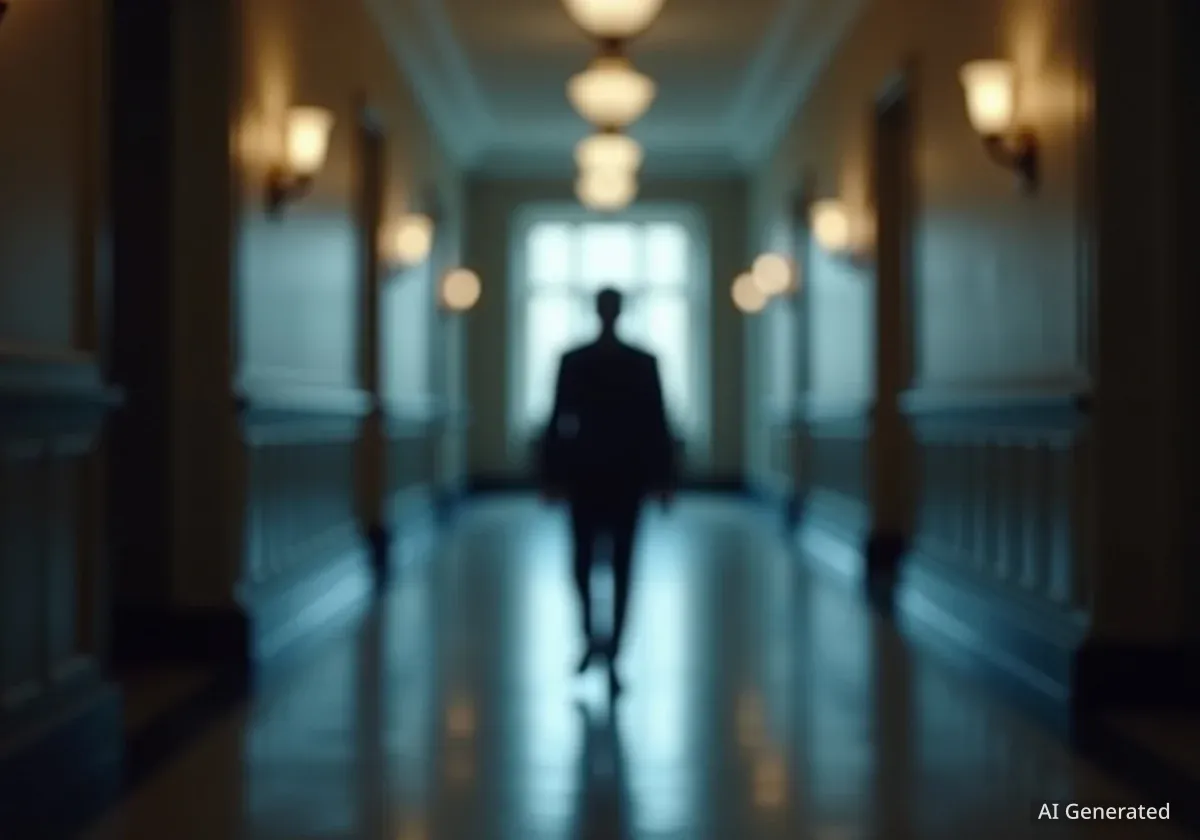Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem brutalen Dreifachmord in Overath wird die Tat neu bewertet. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat den Fall offiziell als politisch motivierte Kriminalität eingestuft. Diese Entscheidung entfacht die Debatte über die wahren Beweggründe des Täters, eines ehemaligen Kölner Ratskandidaten der rechtsextremen Szene, erneut.
Am 7. Oktober 2003 erschoss der damals 30-jährige Neonazi einen Rechtsanwalt, dessen Ehefrau und die gemeinsame Tochter. Während das Kölner Landgericht damals Rache und Habgier als Hauptmotive feststellte, sehen die Behörden heute eine klare politische Dimension, was zu kontroversen Diskussionen führt.
Wichtige Fakten
- Am 7. Oktober 2003 wurden ein Anwalt und seine Familie in Overath ermordet.
- Der Täter war ein bekannter Neonazi und ehemaliger Kölner Ratskandidat.
- Das Landgericht Köln verurteilte ihn wegen Mordes aus Rache und Habgier.
- Die NRW-Landesregierung stufte die Tat nachträglich als politisch motiviert ein.
- Diese Neubewertung führt zu einer anhaltenden Debatte über die Interpretation der Motive.
Die Tat vom Oktober 2003
An einem Herbstnachmittag im Jahr 2003 ereignete sich in Overath eine Tat, die die Region erschütterte. Ein 30-jähriger Mann, der tief in der rechtsextremen Szene verwurzelt war, suchte das Haus eines Rechtsanwalts auf. Dort erschoss er den 46-jährigen Juristen, seine 41-jährige Frau und die 16-jährige Tochter kaltblütig.
Die Ermittlungen führten die Polizei schnell zum Täter und seiner Freundin, die als Mittäterin angeklagt wurde. Der Mann war kein Unbekannter. Er hatte 1994 für die rechtsextreme Organisation „Deutsche Liga für Volk und Heimat“ – eine Vorgängerin von „Pro Köln“ – für den Kölner Stadtrat kandidiert. Seine radikale Gesinnung war den Behörden bekannt.
Hintergrund des Täters
Der Täter war bereits vor der Tat in rechtsextremen Kreisen aktiv. Seine Kandidatur für den Kölner Stadtrat im Stadtteil Nippes war ein Versuch, politisch Fuß zu fassen. Berichten zufolge soll der Verfassungsschutz in dieser Zeit versucht haben, ihn als V-Mann anzuwerben, um Informationen aus der Kölner Neonazi-Szene zu erhalten.
Der Prozess und das Urteil des Gerichts
Während des Prozesses vor dem Kölner Landgericht versuchte der Täter, sich als politischer Kämpfer zu inszenieren. Er behauptete, Teil einer großen Untergrundbewegung zu sein, die auf ein Signal zum Losschlagen warte. In einem Brief an den Kölner Stadt-Anzeiger und auch vor Gericht beschrieb er sich als Vorkämpfer einer revolutionären Bewegung.
Sein Verteidiger argumentierte, der Prozess müsse vor der Staatsschutzkammer in Düsseldorf verhandelt werden, da Anschläge auf jüdische Mitbürger geplant gewesen seien. Dies sollte die politische Motivation der Tat unterstreichen. Die Kölner Richter folgten dieser Darstellung jedoch nicht.
„Das Gericht sah das alles als wenig glaubhaft an. Der Mann war ein Wirrkopf“, erklärte der damalige Prozessberichterstatter Axel Spilcker. Er habe sich in „eine Welt hineingesponnen“, die nichts mit der Realität zu tun habe.
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Hauptmotive Rache und Habgier waren. Der Täter hatte den Anwalt für persönliche und finanzielle Probleme verantwortlich gemacht. Die Richter sahen seine politischen Äußerungen als Schutzbehauptungen und Versuche der Selbstinszenierung. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.
Die politische Neubewertung des Falls
Jahre nach dem Urteil rückte der Fall erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Im Zuge einer landesweiten Überprüfung alter Kriminalfälle auf mögliche rechtsextreme Hintergründe entschied die nordrhein-westfälische Landesregierung unter Innenminister Herbert Reul (CDU), den Dreifachmord von Overath neu zu klassifizieren.
Das Innenministerium erklärte, dass die Tat nachträglich als politisch motiviertes Tötungsdelikt in den offiziellen Statistiken erfasst werden müsse. Diese Entscheidung basierte auf einer Neubewertung aus heutiger Perspektive, die eine politische Dimension der Tat als wahrscheinlich ansieht.
Statistische Erfassung politischer Kriminalität
Die nachträgliche Einstufung von Straftaten als politisch motiviert ist ein wichtiges Instrument, um das wahre Ausmaß von Extremismus zu erkennen. In den vergangenen Jahren haben Sicherheitsbehörden in ganz Deutschland begonnen, Altfälle neu zu prüfen, um ein genaueres Bild von politisch motivierter Gewalt zu erhalten.
Bereits 2019 hatte der damalige LKA-Chef Frank Hoever geäußert, dass das Verbrechen „überwiegend rechts motiviert“ gewesen sei. Die offizielle Neubewertung durch das Ministerium folgte dieser Einschätzung und setzte ein politisches Zeichen im Umgang mit rechtsextremer Gewalt.
Kontroverse um das wahre Motiv
Die Entscheidung der Landesregierung bleibt umstritten. Kritiker, darunter der Prozessreporter Spilcker, halten an der Einschätzung des Gerichts fest. Sie argumentieren, dass die Richter damals alle Beweise sorgfältig geprüft und die Selbstdarstellung des Täters als das entlarvt hätten, was sie war: eine unglaubwürdige Inszenierung.
Die zentrale Frage, die bis heute im Raum steht, lautet: Kann man die politische Ideologie eines Gewalttäters von seiner Tat trennen, auch wenn er selbst eine politische Motivation angibt? Die Befürworter der Neubewertung argumentieren, dass die rechtsextreme Weltanschauung des Täters die Grundlage für seine Gewaltbereitschaft und seinen Hass bildete, auch wenn persönliche Motive wie Rache eine Rolle gespielt haben mögen.
Die Debatte wirkt nach
Die Diskussion um den Dreifachmord von Overath ist symptomatisch für einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs über den Umgang mit Rechtsextremismus. Es geht darum, wie Taten bewertet, Motive interpretiert und die Gefahr, die von radikalisierten Einzeltätern ausgeht, eingeschätzt werden.
- Gerichtliche Perspektive: Fokussiert auf die juristisch nachweisbaren Motive wie Habgier und Rache zur Feststellung der Schuld.
- Politische Perspektive: Berücksichtigt die ideologische Grundlage des Täters und die gesellschaftliche Gefahr, die von seiner Gesinnung ausgeht.
Der Fall Overath zeigt, wie komplex die Aufarbeitung solcher Verbrechen ist. Während die juristische Schuldfrage geklärt ist, bleibt die gesellschaftliche und politische Einordnung der Tat ein Thema, das auch nach über 20 Jahren noch für Debatten sorgt. Es verdeutlicht die Herausforderung, die Motive eines Menschen vollständig zu ergründen, wenn persönliche Rachegefühle und radikale politische Ideologien miteinander verschmelzen.