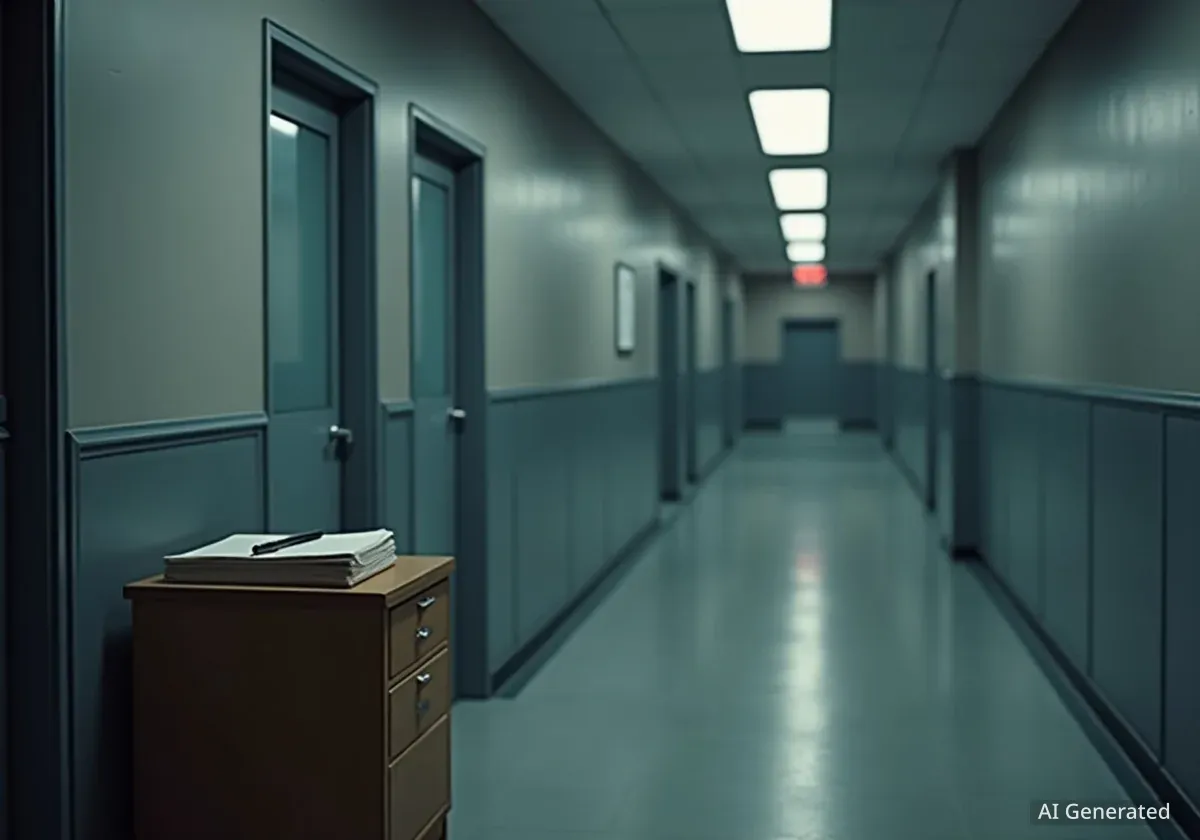Der deutsche Sozialstaat steht vor erheblichen Herausforderungen. Sebastian Siegloch, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität zu Köln, plädiert für eine grundlegende Reform des Systems. Er schlägt vor, Doppelstrukturen abzubauen, Arbeitsanreize zu verbessern und neue Einnahmequellen zu erschließen, insbesondere durch eine Anpassung der Erbschaftssteuer.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Sozialstaat ist in Deutschland tief verankert, aber seine Umsetzung wird kritisiert.
- Ineffiziente Doppelstrukturen und fehlende Arbeitsanreize im Bürgergeld-System sind Probleme.
- Die Rentenversicherung ist der größte Posten der Sozialausgaben und benötigt Reformen.
- Längere Arbeitszeiten und eine höhere Fachkräftezuwanderung sind mögliche Lösungen für die Rente.
- Eine Reform der Erbschaftssteuer könnte neue Einnahmen generieren und soziale Ungleichheit reduzieren.
Kritik am Bürgergeld und mangelnde Anreize
Die aktuelle Debatte um den Sozialstaat konzentriert sich oft auf das Bürgergeld und die Arbeitslosigkeit. Professor Siegloch betont, dass der Sozialstaat viel mehr umfasst. Er sieht jedoch Handlungsbedarf bei der Grundsicherung.
Ein Kernproblem sind die **ineffizienten Doppelstrukturen**. So sind Leistungen wie Wohngeld und Bürgergeld oft nicht gut aufeinander abgestimmt. Dies führt zu einer hohen Komplexität und mangelnder Transparenz für die Betroffenen.
„Für den Einzelnen ist es schwer zu durchschauen, ob es sich da lohnt, 100 Euro mehr zu verdienen oder sich besser nicht weiterzuentwickeln“, sagt Siegloch.
Faktencheck Bürgergeld
- Es gibt Situationen, in denen Bürgergeldempfänger bei mehr Bruttoeinkommen weniger Netto zur Verfügung haben.
- Ein Dickicht an Unterstützungsleistungen wie Wohngeld und Kinderzuschlag erschwert die Übersicht.
- Die Berechnungsmodelle dieser Leistungen sind teils unterschiedlich.
Diese Komplexität führt dazu, dass die Anreize, eine Arbeit aufzunehmen oder mehr zu arbeiten, oft nicht ausreichend sind. Eine Vereinfachung der Systeme könnte hier Abhilfe schaffen.
Professor Siegloch hofft, dass eine bessere Abstimmung der Systeme mehr Menschen zur Aufnahme einer Arbeit motivieren würde. Dies würde die Sozialsysteme entlasten und langfristig Steuereinnahmen generieren. Er räumt jedoch ein, dass die Hoffnung auf schnelle Veränderungen gering ist, da die Probleme seit Langem bekannt sind und bisher wenig geschehen ist.
Die Rentenversicherung: Ein großer Posten
Zwei von drei Euro aller Sozialausgaben fließen in die Rentenversicherung. Dieses Thema wird in der Politik jedoch oft gemieden, da es unpopuläre Entscheidungen erfordert. Die Rentenkassen stehen seit Jahren unter Druck, und die demografische Entwicklung verschärft die Situation weiter.
Hintergrund: Demografischer Wandel
Der demografische Wandel in Deutschland bedeutet, dass die Bevölkerung altert und die Zahl der Erwerbstätigen im Verhältnis zu den Rentnern sinkt. Dies stellt eine große Herausforderung für die Finanzierung der Rentenversicherung dar.
Siegloch nennt mehrere Optionen, um das Rentenproblem anzugehen:
- **Geburtenrate erhöhen:** Politisch nur begrenzt steuerbar.
- **Zuzug von Fachkräften:** Wäre vorteilhaft, aber politisch umstritten.
- **Sozialabgaben erhöhen:** Würde Arbeit weiter verteuern.
- **Steuermittel umleiten:** Würde an anderer Stelle fehlen.
- **Länger arbeiten:** Wahrscheinlich unvermeidlich und aus Sicht Sieglochs gerechtfertigt.
Er argumentiert, dass Menschen dank höherer Lebenserwartung auch länger aktiv und produktiv bleiben können. Dies erfordert jedoch kreative Lösungen, insbesondere für körperlich anstrengende Berufe.
Flexible Lösungen für längeres Arbeiten
Für Berufe mit hoher körperlicher Belastung schlägt Siegloch innovative Ansätze vor. Ein Polier könnte beispielsweise eine Umschulung erhalten und beratend in der Bauaufsicht tätig werden. Dies würde seine langjährige Erfahrung nutzen und ihn körperlich entlasten.
Es gibt bereits erste Programme in Deutschland und Versuche in anderen Ländern. Hier sei es wichtig, zu experimentieren und wirksame Programme zu finden. Dies wird ein Schlüsselthema für die Zukunft der Rentenversicherung sein.
Vereinheitlichung des Sozialsystems und Erbschaftssteuer
Ein weiterer Vorschlag ist die Einbeziehung von Beamten und Selbstständigen in die Rentenkasse. Dies könnte die Einnahmen kurz- bis mittelfristig stabilisieren. Aus ökonomischer Sicht wäre dies sinnvoll, da diese Gruppen oft gut verdienen und die Kassen stützen würden.
Siegloch geht noch weiter und schlägt eine radikale Vereinfachung vor: alle Sozialversicherungsabgaben könnten gestrichen und die Sozialversicherungen über die Einkommensteuer finanziert werden. Dies würde Beamte und Selbstständige automatisch integrieren und das System transparenter und effizienter machen.
Probleme der aktuellen Besteuerung
- Einkommensteuer ist progressiv (Wer mehr verdient, zahlt mehr).
- Sozialversicherungsabgaben sind degressiv (Belastung sinkt bei höherem Einkommen).
- Mehrwertsteuer belastet Geringverdiener stärker, da sie ihr gesamtes Einkommen konsumieren müssen.
Diese Vision ist zwar noch fiktiv und mit juristischen Hürden verbunden, aber sie bietet eine Diskussionsgrundlage für eine grundlegende Vereinfachung und den Abbau von Doppelstrukturen.
Reform der Erbschaftssteuer
Die Finanzierung des Sozialstaats muss auch über neue Einnahmequellen nachgedacht werden. Professor Siegloch kritisiert, dass Vermögen und Erbschaften in Deutschland relativ gering besteuert werden. Er fordert eine Reform der Erbschaftssteuer.
Das Argument, eine hohe Erbschaftssteuer würde mittelständische Unternehmen gefährden, relativiert er. Es gäbe Möglichkeiten, dies zu regeln, etwa durch reduzierte Verschonungen von Betriebsvermögen bei gleichzeitiger Stundung oder Ratenzahlung der Steuern.
„Es gibt absurde Regelungen, nach denen die reichsten Erben überhaupt keine Steuern zahlen, und das Gesetz lässt allerlei Tricks zu, die man nutzen kann, um seine Steuern zu senken“, kritisiert Siegloch.
Der effektive Steuersatz in Deutschland ist im internationalen Vergleich sehr niedrig. Dies führt zu verlorenen Steuereinnahmen und zementiert eine soziale Schieflage. Studien zeigen, dass eine höhere Erbschaftssteuer langfristig die Vermögensungleichheit reduzieren und die soziale Gerechtigkeit stärken könnte.
Ursachen der Finanzierungsprobleme
Die aktuellen Finanzierungsprobleme der Sozialsysteme sind vielfältig. Neben gestiegenen Kosten durch Krisen wie den Ukraine-Krieg und die Covid-Pandemie spielen auch hausgemachte Probleme eine Rolle.
- **Demografischer Wandel:** Zu lange ignoriert.
- **Schleppende Digitalisierung:** Hemmt Effizienz.
- **Lähmende Bürokratie:** Verursacht hohe Kosten.
- **Große Investitionslücke:** Insbesondere in der Infrastruktur.
- **Druck auf Kernindustrien:** Zögerliches Handeln, zum Beispiel bei der E-Mobilität der Autoindustrie, führt zu Wettbewerbsnachteilen.
Die Regierung muss daher nicht nur sparen, sondern auch über neue Einnahmequellen nachdenken. Eine umfassende Reform des Sozialstaats ist laut Siegloch unerlässlich, um die Zukunftsfähigkeit des Systems zu sichern.