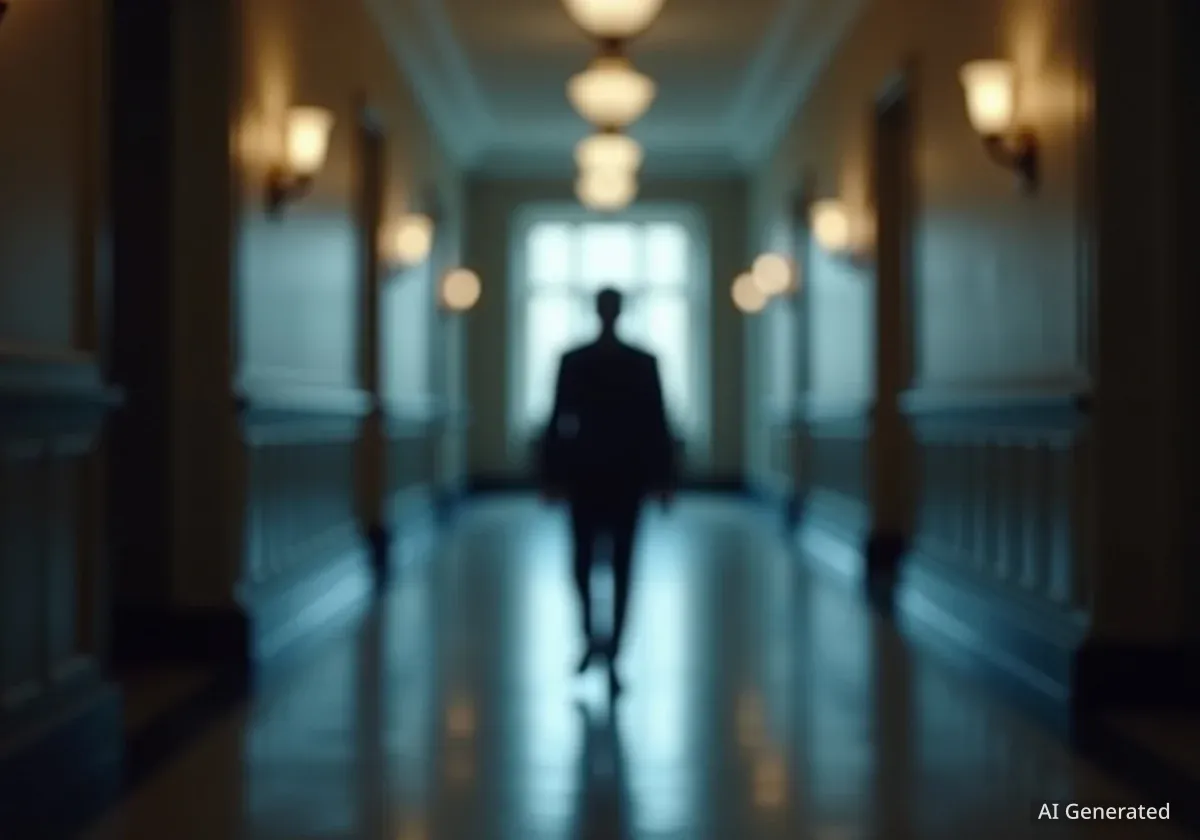Zehn Jahre sind vergangen seit dem Messerangriff auf die damalige Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker. Die Tat am 17. Oktober 2015 erschütterte die Stadt und das ganze Land. Der Angriff, verübt einen Tag vor der Wahl, war ein politisch motivierter Anschlag, der die Verletzlichkeit der lokalen Demokratie aufzeigte.
Heute, ein Jahrzehnt später, sind die physischen Wunden verheilt, doch die gesellschaftlichen Folgen und die Erinnerungen der Beteiligten bleiben präsent. Die Oberbürgermeisterin, die den Angriff überlebte und die Wahl aus dem künstlichen Koma gewann, hat die Tat verarbeitet. Doch der Vorfall wirft weiterhin wichtige Fragen zur Sicherheit von Politikern und zum Umgang mit politischem Extremismus auf.
Wichtige Fakten im Überblick
- Der Angriff: Am 17. Oktober 2015 stach der Rechtsextremist Frank S. Henriette Reker auf einem Wochenmarkt in Köln-Braunsfeld in den Hals.
- Die Opfer: Neben Reker wurden vier weitere Personen bei dem Angriff verletzt.
- Das Motiv: Der Täter handelte aus Hass auf die Flüchtlingspolitik, für die Reker als Sozialdezernentin mitverantwortlich war.
- Das Urteil: Frank S. wurde 2016 wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt.
- Die Folgen: Die Tat löste eine bundesweite Debatte über die Zunahme von Gewalt gegen Politiker aus.
Der Tag des Angriffs in Köln-Braunsfeld
Es war ein Samstagmorgen, der letzte Tag des Wahlkampfes zur Oberbürgermeisterwahl in Köln. Henriette Reker, die gemeinsame Kandidatin von CDU, Grünen und FDP, verteilte Rosen an Bürgerinnen und Bürger auf dem Wochenmarkt in Braunsfeld. Als damalige Sozialdezernentin war sie für die Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt zuständig, was sie zur Zielscheibe von Rechtsextremisten machte.
Kurz nach 9 Uhr trat der damals 44-jährige Frank S. an sie heran. Er bat um eine Rose, zog dann aber ein großes Jagdmesser und stach ihr in den Hals. Die Klinge verfehlte die Halsschlagader nur knapp. Reker brach schwer verletzt zusammen. Der Täter verletzte mit einem zweiten Messer vier weitere Personen, die Reker zu Hilfe eilen wollten: ihren Mitarbeiter Pascal Siemens sowie die Politikerinnen Marliese Berthmann (CDU), Katja Hoyer (FDP) und Anette von Waldow (FDP).
Augenzeugen berichteten, dass der Täter nach der Tat Parolen wie „Reker, Merkel, Flüchtlingsschwemme“ rief. Er wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Später gab er an, er habe ursprünglich Bundeskanzlerin Angela Merkel angreifen wollen, sei aber nicht an sie herangekommen.
Der Täter und das Gerichtsverfahren
Ein Täter aus dem rechtsextremen Milieu
Frank S., ein arbeitsloser Maler aus Köln-Nippes, war den Behörden bereits aus der Bonner Neonazi-Szene bekannt. Ermittlungen zeigten, dass er sich über das Internet zunehmend radikalisiert hatte. Sein Weltbild war von Hass auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und einer tiefen Ablehnung des Staates geprägt.
Das Urteil des Oberlandesgerichts
Im Juli 2016 verurteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf Frank S. wegen versuchten Mordes und vierfacher gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Das Gericht sah das Motiv in seinem Ziel, „ein Signal gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu setzen“ und „ein Klima der Angst zu schaffen“. Auf eine lebenslange Haftstrafe wurde verzichtet, da das Gericht das Mordmerkmal der „niedrigen Beweggründe“ nicht als erfüllt ansah. Die Begründung lautete, der Täter habe im „vermeintlichen Allgemeininteresse“ gehandelt.
Heute verbüßt Frank S. seine Strafe in einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen. Anfragen zu seinem heutigen Zustand oder einer möglichen vorzeitigen Entlassung werden von den Behörden unter Verweis auf Persönlichkeitsrechte nicht beantwortet. Einem Interview mit der Presse stimmte er zunächst zu, zog seine Zusage aber später ohne Angabe von Gründen zurück.
Die Perspektive der Opfer
Henriette Rekers Umgang mit der Tat
Henriette Reker überlebte dank einer Notoperation in der Uniklinik Köln. Am Tag nach dem Attentat wurde sie, noch im künstlichen Koma liegend, zur Oberbürgermeisterin von Köln gewählt. Sie hat die Tat nach eigenen Angaben verarbeitet, weil der Täter sein Ziel nicht erreicht habe. Ein Treffen mit ihm schließt sie nicht gänzlich aus, zeigt aber kein aktives Interesse daran.
„Er interessiert mich einfach gar nicht. Das bedeutet weder, dass ich ihn ablehne, noch, dass ich mich ihm zuwende. Er interessiert mich einfach gar nicht.“
Ihren ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Genesung hatte sie einen Monat nach dem Angriff bei der Verleihung des Heinrich-Böll-Preises an die Schriftstellerin Herta Müller. Dort trug sie ein Tuch, um die Narbe am Hals zu verdecken. Müller prägte bei dieser Gelegenheit den Satz, dass „erst Parolen und dann die Messer spazieren gehen“ – ein Zitat, das Reker seither oft wiederholt hat, um vor der Verrohung der Sprache zu warnen.
Trauma eines Helfers
Martin Bachmann war einer der Ersthelfer am Tatort. Er schlug mit einem Sonnensegel auf den Angreifer ein, um ihn zu entwaffnen. Noch Jahre später litt er unter den psychischen Folgen der Tat. „Wenn ich abends ins Bett gehe, dann sehe ich dieses blutige Messer“, sagte er in einem Interview. Er musste sich mehrfach in stationäre psychologische Behandlung begeben.
Gewalt gegen Politiker: Eine wachsende Bedrohung
Der Angriff auf Henriette Reker war kein Einzelfall, sondern ein Vorbote einer besorgniserregenden Entwicklung. Die Gewalt und die Drohungen gegen Amts- und Mandatsträger haben in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland stark zugenommen. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke am 1. Juni 2019 durch einen Rechtsextremisten markierte einen weiteren tragischen Höhepunkt dieser Entwicklung.
Statistiken belegen das Ausmaß
Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung aus dem Jahr 2022 verdeutlicht das Problem:
- 60 Prozent der Kommunalpolitiker in deutschen Großstädten haben bereits Beschimpfungen oder Beleidigungen erlebt.
- Jeder Dritte war schon von tätlichen Angriffen betroffen.
- Ein Großteil der Aggressionen geht vom rechtsextremen Spektrum aus.
Viele Betroffene kritisieren, dass Anzeigen oft ohne Konsequenzen bleiben. Die Studie bemängelt eine mangelnde Sensibilität bei den Strafverfolgungsbehörden für politisch motivierte Gewalt und fordert eine konsequentere juristische Verfolgung der Täter.
Das Attentat von Köln bleibt somit auch zehn Jahre danach eine Mahnung. Es zeigt, wie aus Worten Taten werden können und wie wichtig der Schutz derjenigen ist, die sich für die Demokratie engagieren. Der Angriff hat nicht nur das Leben von Henriette Reker verändert, sondern auch den Blick des Landes auf die Sicherheit seiner politischen Vertreter nachhaltig geprägt.