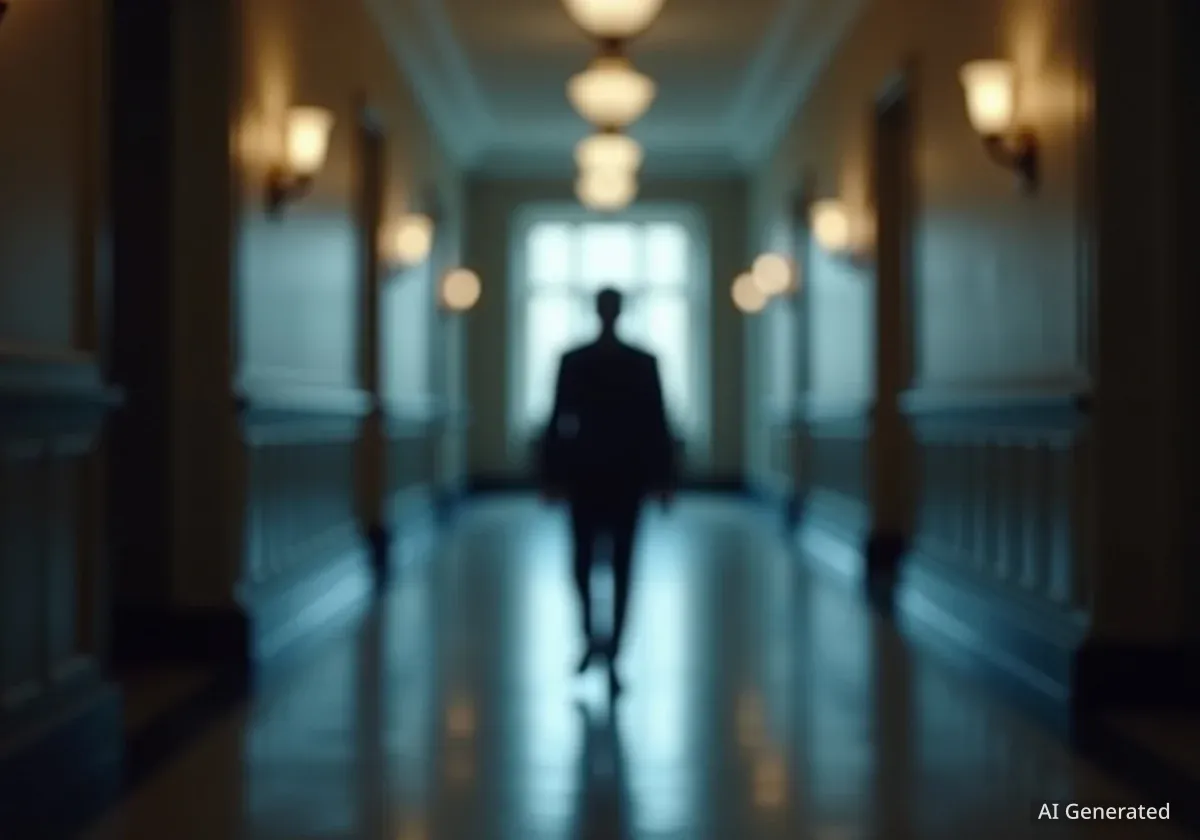Ein Student der Katholischen Hochschule in Köln erlebt sein Auslandsjahr in den USA in einer politisch angespannten Zeit. Benjamin Karenke, 25, studiert seit August an der University of Pittsburgh. Sein Weg dorthin war von Unsicherheit geprägt, nachdem die damalige US-Regierung unter Donald Trump die Vergabe von Studentenvisa vorübergehend stoppte. Nur eine Gerichtsentscheidung ermöglichte ihm die Einreise.
Das Wichtigste in Kürze
- Ein Kölner Student berichtet über sein Auslandsstudium in Pittsburgh während der Trump-Ära.
- Ein kurzzeitiger Visa-Stopp der US-Regierung gefährdete das gesamte Vorhaben.
- Der Student vergleicht das Campusleben und die Lehre in den USA und Deutschland.
- Politische Entscheidungen, wie Kürzungen im Gesundheitswesen, sind auch im Universitätsalltag spürbar.
Ein unsicherer Start ins Auslandsjahr
Für Benjamin Karenke, Masterstudent im Fach „Innovationsmanagement in der Sozialen Arbeit“ an der Katho Köln, sollte das Jahr in Pittsburgh der Höhepunkt seines Studiums werden. Er hatte sich erfolgreich für das renommierte Fulbright-Stipendium beworben – laut Angaben der Hochschule als erster ausländischer Student im Fachbereich Soziale Arbeit an der University of Pittsburgh, kurz „Pitt“.
Die Zusage für das Stipendium erhielt er in der Woche der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Doch Ende Mai folgte ein unerwarteter Rückschlag: Die Trump-Regierung verkündete, dass keine neuen Visa-Termine an US-Konsulaten für ausländische Studierende vergeben werden sollten.
Hintergrund: Der Visa-Stopp
Im Frühjahr 2020 erließ die damalige US-Regierung mehrere Proklamationen, die die Einreise für bestimmte Personengruppen, einschließlich Studenten, einschränkten. Diese Maßnahmen wurden mit der COVID-19-Pandemie und dem Schutz des amerikanischen Arbeitsmarktes begründet, lösten jedoch weltweit bei Studierenden und Universitäten große Unsicherheit aus.
Für Karenke war dies eine Phase großer Anspannung. „Der Flug war schon gebucht, das WG-Zimmer gekündigt“, erklärte er gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Der Gedanke, dass die monatelange Vorbereitung und das anspruchsvolle Bewerbungsverfahren vergeblich gewesen sein könnten, war frustrierend.
„Alles wäre umsonst gewesen. Es war wirklich eine schwierige Zeit, weil ich alle Hürden im Bewerbungsverfahren geschafft hatte.“
Die Wende kam durch eine Gerichtsentscheidung. Eine US-Richterin hob den Visa-Stopp auf und ermöglichte die Wiederaufnahme der Terminvergabe. Aufgrund des entstandenen Rückstaus musste Karenke jedoch lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Zeit bis zum Erhalt des Visums beschrieb er als „reine Zitterpartie“.
Kontraste im Universitätsleben
Nach seiner Ankunft in Pittsburgh tauchte Karenke in ein völlig anderes akademisches Umfeld ein. Der Unterschied zur Katho Köln mit ihren rund 1.500 Studierenden könnte kaum größer sein. An der University of Pittsburgh sind etwa 35.000 Studierende eingeschrieben.
Der Campus der „Pitt“ ist wie eine kleine Stadt in der Stadt. „Man merkt, dass in den Hochschulen in den USA sehr viel mehr Geld drinsteckt“, so Karenke. Die Universität verfügt über eine eigene Polizei, eine eigene Krankenversicherung und zahlreiche Restaurants und Bars. Ein Shuttleservice verbindet die verschiedenen Einrichtungen und Wohnheime.
Infrastruktur und Angebote
Die Ausstattung für Studierende ist beeindruckend und unterscheidet sich stark von deutschen Verhältnissen. Zum Angebot gehören:
- Ein mehrstöckiges Fitnessstudio mit Boulderhalle und Schwimmbad.
- Eine große Eventhalle für die Spiele der Universitätssportmannschaften.
- Eine zentrale Organisation, bei der sich der Alltag fast ausschließlich auf dem Campus abspielt.
„Alles, was wir zum Leben brauchen, findet sich hier. Ich mag es“, fasst Karenke seine Eindrücke zusammen. Dieser in sich geschlossene Kosmos bietet Komfort, bleibt aber von den politischen Realitäten außerhalb des Campus nicht unberührt.
Universität im Vergleich
Katho Köln: ca. 1.500 Studierende, dezentrale Standorte.
University of Pittsburgh: ca. 35.000 Studierende, zentralisierter Campus mit umfassender Infrastruktur.
Spürbare Auswirkungen der Politik
Obwohl Karenke keine persönlichen Konsequenzen wie eine Ausweisung fürchtet, ist die Politik der Trump-Regierung auf dem Campus und in der Stadt präsent. Er berichtet, dass in Pittsburgh viele Migranten von der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE (Immigrations and Customs Enforcement) festgenommen werden. Diese Behörde ist für die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze zuständig.
Auch an der Universität sind die politischen Veränderungen spürbar. Die Regierung zeigte eine ablehnende Haltung gegenüber Programmen zur Förderung von Diversität und Geschlechterforschung. An der „Pitt“ wurde die Abteilung für „Diversity, Equity, Inclusion“ (DIE) umbenannt. „An meiner Fakultät gibt es die Abteilung aber noch. Die stellen sich dagegen“, berichtet Karenke. Der Widerstand in einzelnen Fachbereichen zeigt die internen Debatten an den Hochschulen.
Politik als Thema im Studium
Die Auswirkungen staatlicher Entscheidungen fließen direkt in die Lehre ein. Im Fach Soziale Arbeit, das sich oft mit marginalisierten Gruppen befasst, sind die politischen Rahmenbedingungen ein zentrales Thema.
„In meinen Kursen, etwa für Mental Health, sind die staatlichen Kürzungen auch im Gesundheitsbereich Thema“, erklärt Karenke. Er bekomme mit, dass Migranten aus Angst vor einer Datenweitergabe an die Ausweisungsbehörde zögern, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dieses Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen erschwert die soziale Arbeit vor Ort erheblich.
Unterschiede in der Ausbildung
Neben dem Studium absolviert Karenke ein Praktikum, um die amerikanische Soziale Arbeit in der Praxis kennenzulernen. Sein Eindruck ist positiv: „Ich habe das Gefühl, die Ausbildung zum Sozialarbeiter ist ziemlich gut und sehr professionell.“ Er lerne konkrete Techniken, um wertschätzend mit Menschen zu kommunizieren, die beispielsweise von Rassismus betroffen sind.
Das Studium selbst empfindet er als arbeitsintensiver als in Deutschland. Das Lesepensum sei deutlich höher. Die Lehre sei stark an der Praxis orientiert und weniger abstrakt. Im Gegenzug schätzt er am deutschen System, dass es Studierende besser darauf vorbereitet, „eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten“, also eigene Recherchen durchzuführen und Forschungsfragen zu entwickeln.
Sein Auslandsjahr bietet ihm somit nicht nur Einblicke in eine andere Kultur, sondern auch in ein anderes akademisches System – geprägt von exzellenter Ausstattung, hohem Praxisbezug und den unübersehbaren Folgen politischer Entscheidungen.