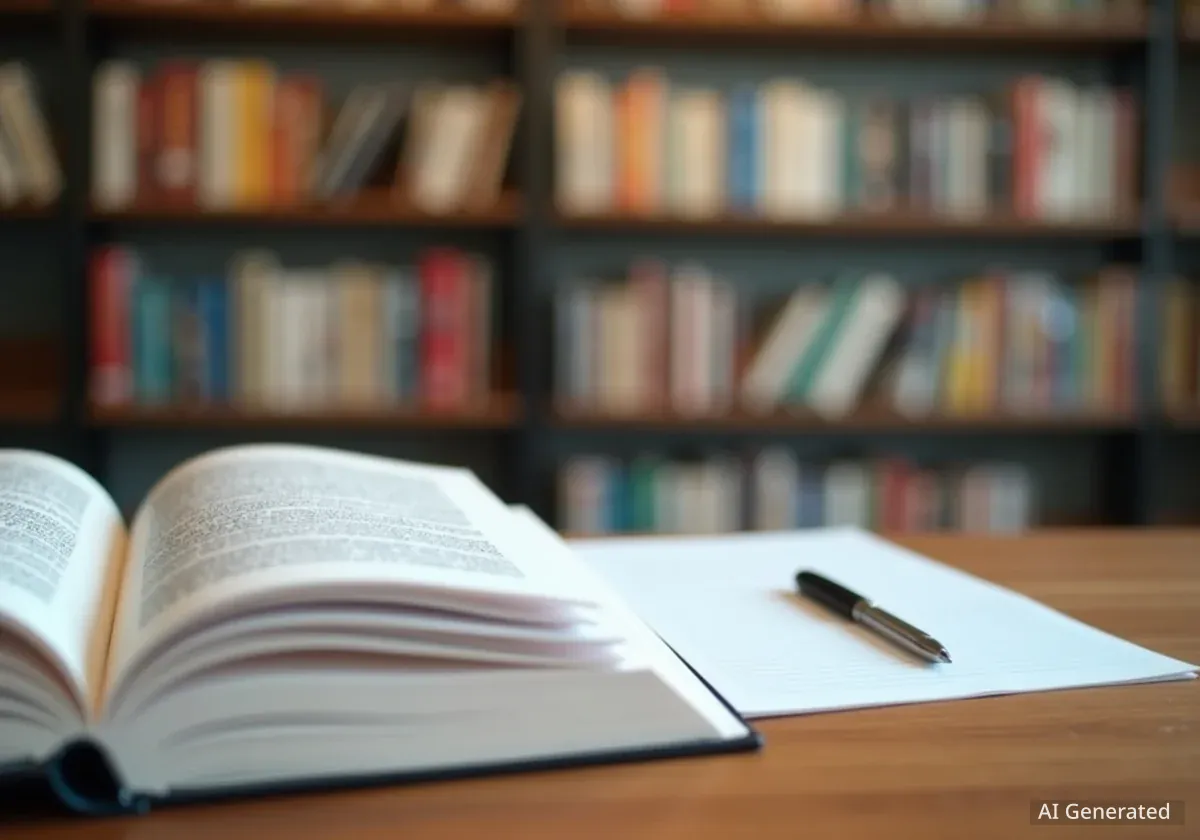Das Landesarbeitsgericht Köln hat die Kündigung einer Professorin der Universität Bonn für rechtmäßig erklärt. In einem am 30. September 2025 verkündeten Urteil wies die 10. Kammer die Berufung der Wissenschaftlerin zurück. Die Entscheidung bestätigt ein früheres Urteil des Arbeitsgerichts Bonn und stellt fest, dass die ordentliche Kündigung zum 31. März 2023 wirksam ist.
Grund für die Entlassung war die Vorlage einer wissenschaftlichen Arbeit im Bewerbungsverfahren, die erhebliche Plagiate enthielt. Das Gericht wertete dies als schwerwiegende Pflichtverletzung, die das Vertrauensverhältnis zur Universität zerstört hat.
Wichtige Punkte
- Das Landesarbeitsgericht Köln hat die Kündigung einer Bonner Professorin bestätigt.
- Grund war die Einreichung einer plagiierten wissenschaftlichen Arbeit im Bewerbungsverfahren.
- Das Gericht sah die Einhaltung wissenschaftlicher Standards als Kernpflicht einer Hochschullehrerin an.
- Eine vorherige Abmahnung war nach Ansicht des Gerichts nicht erforderlich.
- Die Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen.
Hintergründe des Falls
Die Auseinandersetzung begann, als die Universität Bonn das Arbeitsverhältnis mit der Professorin ordentlich zum 31. März 2023 kündigte. Die Wissenschaftlerin hatte sich zuvor erfolgreich auf eine Professur beworben und war bereits im Dienst.
Im Nachhinein stellte sich heraus, dass eine der von ihr eingereichten Publikationen, die als Nachweis ihrer wissenschaftlichen Qualifikation diente, nicht den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis entsprach. Konkret wurden ihr zahlreiche nicht gekennzeichnete Textübernahmen aus anderen Werken vorgeworfen – ein klassischer Fall von Plagiat.
Die Professorin klagte gegen ihre Entlassung vor dem Arbeitsgericht Bonn. Nachdem ihre Klage dort abgewiesen wurde, legte sie Berufung beim Landesarbeitsgericht in Köln ein, das nun ebenfalls zugunsten der Universität entschied.
Der juristische Weg
Der Fall durchlief zwei Instanzen des deutschen Arbeitsrechts. Zuerst entschied das Arbeitsgericht Bonn als erste Instanz. Nachdem die Klägerin dort unterlag, ging der Fall an das Landesarbeitsgericht Köln als Berufungsinstanz. Dessen Urteil ist nun rechtskräftig, da die Revision zum Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen wurde.
Die Argumentation des Gerichts
Die 10. Kammer des Landesarbeitsgerichts unter dem Vorsitz von Dr. Schramm begründete ihre Entscheidung umfassend. Die Richter stellten klar, dass von Bewerbern auf eine Professur erwartet wird, dass sie wahrheitsgemäße Angaben machen und ausschließlich Arbeiten vorlegen, die wissenschaftlichen Standards genügen.
Verletzung der Wahrheitspflicht
Das Gericht argumentierte, dass die Professorin bereits im Bewerbungsverfahren zentrale Pflichten verletzt habe. Mit der Vorlage der plagiierten Arbeit habe sie konkludent, also durch schlüssiges Handeln, erklärt, dass diese Publikation ihren eigenen geistigen Schöpfungsprozess darstellt und frei von wissenschaftlichem Fehlverhalten ist.
„Durch die Vorlage einer mit Plagiaten behafteten Veröffentlichung habe die Klägerin diese Pflichten verletzt. Nach Überzeugung der Kammer habe die Klägerin dabei zumindest billigend in Kauf genommen, dass das Werk nicht den wissenschaftlichen Standards genügte.“
Die hohe Anzahl an nicht als Zitate gekennzeichneten Passagen belege, dass dies kein Versehen war. Die Kammer ging davon aus, dass die Klägerin die Mängel ihrer Arbeit kannte oder zumindest damit rechnete, dass solche vorhanden waren.
Kernbereich wissenschaftlicher Tätigkeit betroffen
Die Richter betonten die besondere Bedeutung der wissenschaftlichen Integrität. Die Einhaltung dieser Standards sei keine Nebensächlichkeit, sondern eine zentrale Anforderung an das Berufsbild eines Hochschullehrers.
Ein Verstoß, wie er der Klägerin vorgeworfen wird, berührt laut Urteil den „Kernbereich des Selbstverständnisses einer wissenschaftlich Tätigen“. Ein solches Verhalten untergräbt das Vertrauen in die Fähigkeit der Person, zukünftig in Forschung und Lehre korrekt zu arbeiten.
Was ist wissenschaftliches Fehlverhalten?
Als wissenschaftliches Fehlverhalten gelten unter anderem:
- Plagiat: Die Übernahme fremder Texte oder Ideen ohne Kennzeichnung.
- Datenfälschung: Das Erfinden oder Manipulieren von Forschungsdaten.
- Sabotage: Die absichtliche Störung der Forschungstätigkeit anderer.
Diese Vergehen werden in der Wissenschaftsgemeinschaft streng geahndet und können zu beruflichen Konsequenzen bis hin zum Entzug akademischer Titel führen.
Warum keine Abmahnung erforderlich war
Normalerweise muss einer Kündigung im Arbeitsrecht eine Abmahnung vorausgehen. Sie soll dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, sein Verhalten zu ändern. In diesem Fall sah das Gericht eine Abmahnung jedoch als entbehrlich an.
Die Begründung: Die Pflichtverletzung wiege so schwer, dass der Universität die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden könne. Das Vertrauensverhältnis sei durch die Täuschung im Bewerbungsverfahren nachhaltig zerstört worden.
Das Gericht führte eine Interessenabwägung durch. Auf der einen Seite stand das Interesse der Professorin am Erhalt ihres Arbeitsplatzes. Da sie erst kurz an der Universität beschäftigt war, bewertete das Gericht ihren Bestandsschutz als „nicht sehr ausgeprägt“.
Auf der anderen Seite stand das Interesse der Universität am Schutz ihrer Reputation und der Integrität des Wissenschaftsbetriebs. Dieses Interesse wog nach Ansicht der Richter deutlich schwerer.
Bedeutung des Urteils für die Wissenschaft
Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln (Aktenzeichen: 10 SLa 289/24) sendet ein klares Signal an die akademische Gemeinschaft. Es unterstreicht die enorme Wichtigkeit von Ehrlichkeit und Transparenz, insbesondere im Bewerbungsprozess für verantwortungsvolle Positionen wie eine Professur.
Universitäten haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die wissenschaftliche Qualifikation ihrer Bewerber genau zu prüfen. Stellt sich heraus, dass diese auf Täuschung beruht, können sie auch nach der Einstellung arbeitsrechtliche Konsequenzen ziehen.
Die Entscheidung stärkt die Position von Hochschulen im Kampf gegen wissenschaftliches Fehlverhalten. Sie macht deutlich, dass Plagiate nicht nur ein Kavaliersdelikt sind, sondern eine schwerwiegende Verfehlung, die eine Karriere beenden kann. Die Revision wurde nicht zugelassen, womit das Urteil rechtskräftig ist.