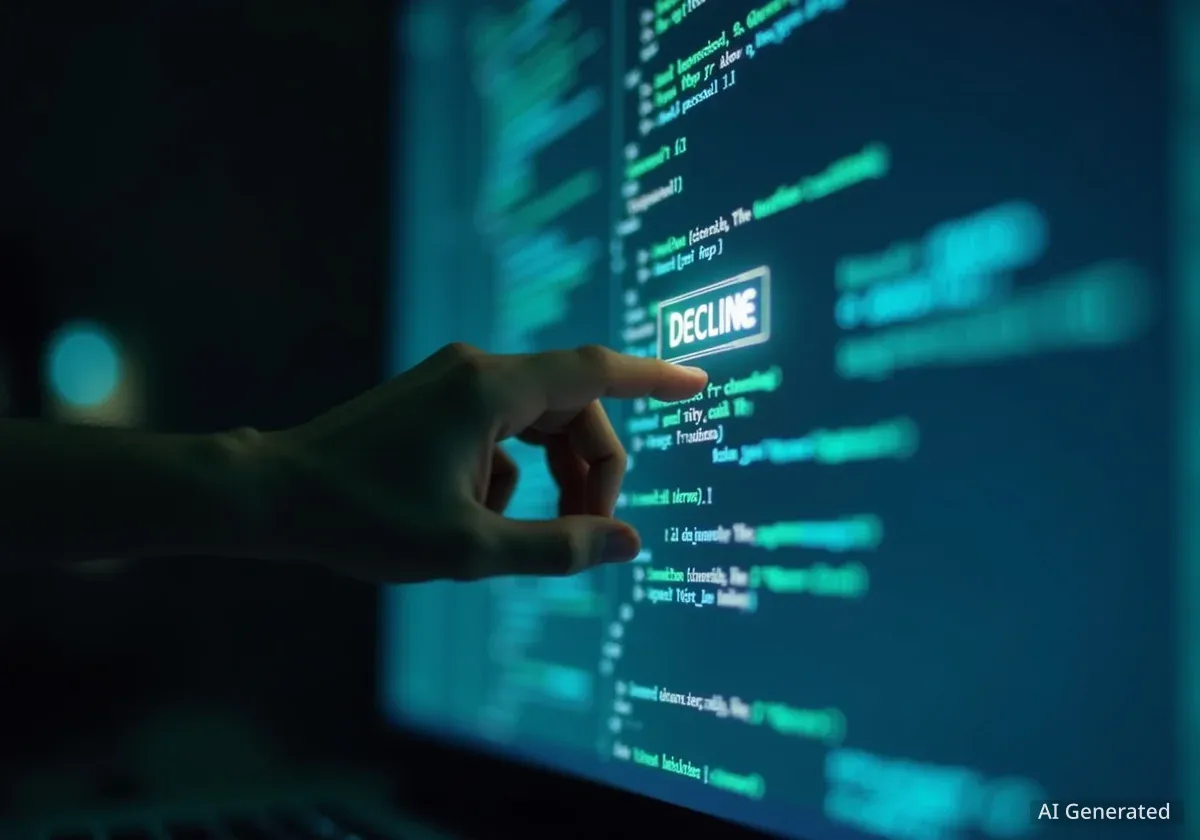Immer mehr Nutzer von Online-Nachrichtenseiten in Deutschland stehen vor der Wahl: ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder der Nutzung ihrer persönlichen Daten für Werbezwecke zustimmen. Dieses Modell, bekannt als „Leistung gegen Daten“ oder „Pur-Abo-Modell“, hat sich als gängige Methode zur Finanzierung von Journalismus etabliert, wirft aber auch wichtige Fragen zum Datenschutz auf.
Die rechtliche Grundlage für dieses Vorgehen findet sich in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und im deutschen Zivilrecht. Es handelt sich im Kern um einen Vertrag, bei dem der Nutzer nicht mit Geld, sondern mit seinen Daten für den Zugang zu journalistischen Inhalten bezahlt. Doch was genau bedeutet das für die Verbraucher und welche Informationen werden dabei preisgegeben?
Wichtige Erkenntnisse
- Das „Leistung gegen Daten“-Modell ist eine Alternative zu bezahlten Abonnements, um Online-Journalismus zu finanzieren.
- Nutzer schließen einen Vertrag ab, bei dem persönliche Daten als Gegenleistung für den Zugang zu Inhalten dienen.
- Die rechtliche Basis bilden die DSGVO (Art. 6 Abs. 1 lit. b) und das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).
- Gesammelt werden vor allem Daten zum Nutzungsverhalten, um personalisierte Werbung auszuspielen.
- Datenschützer kritisieren, dass die Freiwilligkeit der Einwilligung oft nicht gegeben ist.
Was genau bedeutet „Leistung gegen Daten“?
Das Konzept „Leistung gegen Daten“ beschreibt ein Geschäftsmodell, bei dem ein digitaler Dienst – wie der Zugang zu Nachrichtenartikeln – nicht gegen eine monetäre Zahlung, sondern im Austausch für die Erlaubnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten bereitgestellt wird. Für den Nutzer bedeutet das: Entweder er zahlt einen monatlichen Betrag für ein werbe- und trackingfreies „Pur-Abonnement“ oder er stimmt der Sammlung und Nutzung seiner Daten zu.
Diese Zustimmung erlaubt es dem Webseitenbetreiber und seinen Partnern, das Verhalten des Nutzers zu analysieren. Dazu gehören Informationen darüber, welche Artikel gelesen, wie lange auf einer Seite verweilt und auf welche Links geklickt wird. Diese Erkenntnisse dienen primär dazu, personalisierte Werbung auszuspielen, die auf die Interessen des jeweiligen Nutzers zugeschnitten ist.
Aus rechtlicher Sicht wird hier ein Vertrag geschlossen. Der Anbieter stellt den journalistischen Inhalt zur Verfügung (die Leistung), und der Nutzer erbringt seine Gegenleistung durch die Bereitstellung seiner Daten. Dieses Modell ist besonders in der Medienbranche verbreitet, da es eine Antwort auf die sinkende Bereitschaft vieler Menschen ist, für Online-Nachrichten direkt zu bezahlen.
Die rechtliche Grundlage in Deutschland und der EU
Die Zulässigkeit des „Bezahlen mit Daten“-Modells stützt sich auf eine Kombination aus europäischem Datenschutzrecht und nationalem Zivilrecht. Die Betreiber von Nachrichtenseiten argumentieren, dass es sich um einen freiwilligen Vertrag handelt, der durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gedeckt ist.
Der Vertragscharakter nach DSGVO und BGB
Die zentrale Vorschrift ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO. Dieser Artikel erlaubt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn sie „für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist“. Die Webseitenbetreiber argumentieren, dass der Zugang zu den Inhalten genau ein solcher Vertrag ist.
Unterstützt wird diese Auslegung durch neuere Regelungen im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Insbesondere die Paragrafen § 312 Abs. 1a und § 327 Abs. 3 BGB erkennen explizit an, dass Verbraucher Verträge über digitale Produkte auch durch die Bereitstellung von personenbezogenen Daten abschließen können.
Hintergrund: Die DSGVO
Die Datenschutz-Grundverordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, die seit Mai 2018 in Kraft ist. Ihr Ziel ist es, die Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen in der EU zu vereinheitlichen und die Rechte der Bürger auf informationelle Selbstbestimmung zu stärken.
Diese rechtliche Konstruktion macht deutlich: Die Daten des Nutzers werden nicht einfach nur als Nebenprodukt gesammelt, sondern sind der offizielle Preis für den digitalen Dienst. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Beziehung zwischen Nutzer und Anbieter.
Welche Daten werden gesammelt und wofür?
Wenn ein Nutzer dem „Daten-statt-Geld“-Modell zustimmt, erteilt er die Erlaubnis zur Sammlung einer Vielzahl von Informationen. Diese gehen oft über einfache Cookies hinaus und können ein detailliertes Profil der Person erstellen.
- Geräte-IDs und technische Informationen: Jeder Computer oder jedes Smartphone hat eine eindeutige Kennung. Diese wird zusammen mit Informationen über das Betriebssystem, den Browsertyp und die Bildschirmauflösung gespeichert.
- Nutzungsverhalten: Es wird genau verfolgt, welche Artikel der Nutzer liest, welche Videos er ansieht und wie lange er auf bestimmten Seiten verweilt. Auch Suchanfragen innerhalb der Webseite werden erfasst.
- Standortdaten: Sofern freigegeben, kann der ungefähre Standort des Nutzers ermittelt werden, um lokale Werbung oder Inhalte anzuzeigen.
- Kombinierte Profile: Die gesammelten Daten werden oft mit Informationen von Drittanbietern und Werbenetzwerken kombiniert, um noch genauere Nutzerprofile zu erstellen.
Der Hauptzweck dieser Datensammlung ist die Finanzierung des journalistischen Angebots. Durch die genauen Nutzerprofile kann Werbung gezielter und damit teurer verkauft werden. Laut den Anbietern helfen die Daten auch dabei, die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessern und neue digitale Produkte zu entwickeln, die den Interessen der Leserschaft entsprechen.
Datenübermittlung in Drittländer
Ein oft übersehener Aspekt ist die Übermittlung von Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union, beispielsweise in die USA. Gemäß Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO kann dies im Rahmen der Vertragserfüllung zulässig sein, auch wenn in diesen Ländern möglicherweise ein niedrigeres Datenschutzniveau herrscht als in der EU.
Die Kritik von Datenschützern
Obwohl das Modell rechtlich abgesichert scheint, gibt es erhebliche Kritik von Verbraucher- und Datenschützern. Der zentrale Streitpunkt ist die Frage der Freiwilligkeit. Kritiker argumentieren, dass die Entscheidung zwischen der Preisgabe persönlicher Daten und der Zahlung oft hoher monatlicher Gebühren für viele Nutzer keine echte Wahl darstellt.
„Wenn die Alternative zu umfassendem Tracking ein Abonnement ist, das sich viele Menschen nicht leisten können oder wollen, kann von einer wirklich freien Einwilligung keine Rede sein. Es entsteht ein Druck, dem Tracking zuzustimmen, um nicht von Informationen ausgeschlossen zu werden.“
Die Sorge ist, dass eine Zweiklassengesellschaft im Internet entsteht: Diejenigen, die es sich leisten können, kaufen sich ihre Privatsphäre, während alle anderen mit ihren Daten bezahlen müssen. Zudem wird die Komplexität der Datenverarbeitung kritisiert. Für den durchschnittlichen Nutzer ist es kaum nachvollziehbar, welche Daten genau an welche der oft hunderten Werbepartner weitergegeben werden.
Das Widerrufsrecht und seine Grenzen
Nutzer haben zwar grundsätzlich das Recht, ihre Einwilligung zu widerrufen. Da es sich hierbei jedoch um einen Vertrag handelt, ist der Widerruf komplizierter als bei einer einfachen Einwilligung. Ein Widerruf der Datennutzung beendet in der Regel den „Daten-Vertrag“. Das bedeutet, der Nutzer verliert den Zugang zu den Inhalten und muss dann entweder ein bezahltes Abonnement abschließen oder die Seite verlassen. Ein nachträgliches Löschen der bereits gesammelten Daten ist oft nur eingeschränkt möglich.
Fazit: Ein Kompromiss mit Konsequenzen
Das Modell „Leistung gegen Daten“ ist ein Versuch der Medienbranche, hochwertigen Journalismus in der digitalen Welt wirtschaftlich tragfähig zu machen. Es bietet eine Alternative für Nutzer, die nicht bereit sind, für Inhalte direkt mit Geld zu bezahlen. Die rechtlichen Grundlagen in der DSGVO und im BGB schaffen dafür einen Rahmen.
Gleichzeitig verschiebt dieses Modell die Wahrnehmung von persönlichen Daten: Sie werden von einem schützenswerten Gut zu einer handelbaren Währung. Nutzer sollten sich bewusst sein, dass sie mit der Zustimmung zum Tracking einen Vertrag eingehen, dessen Gegenleistung die umfassende Analyse ihres digitalen Verhaltens ist. Eine informierte Entscheidung ist daher wichtiger denn je.