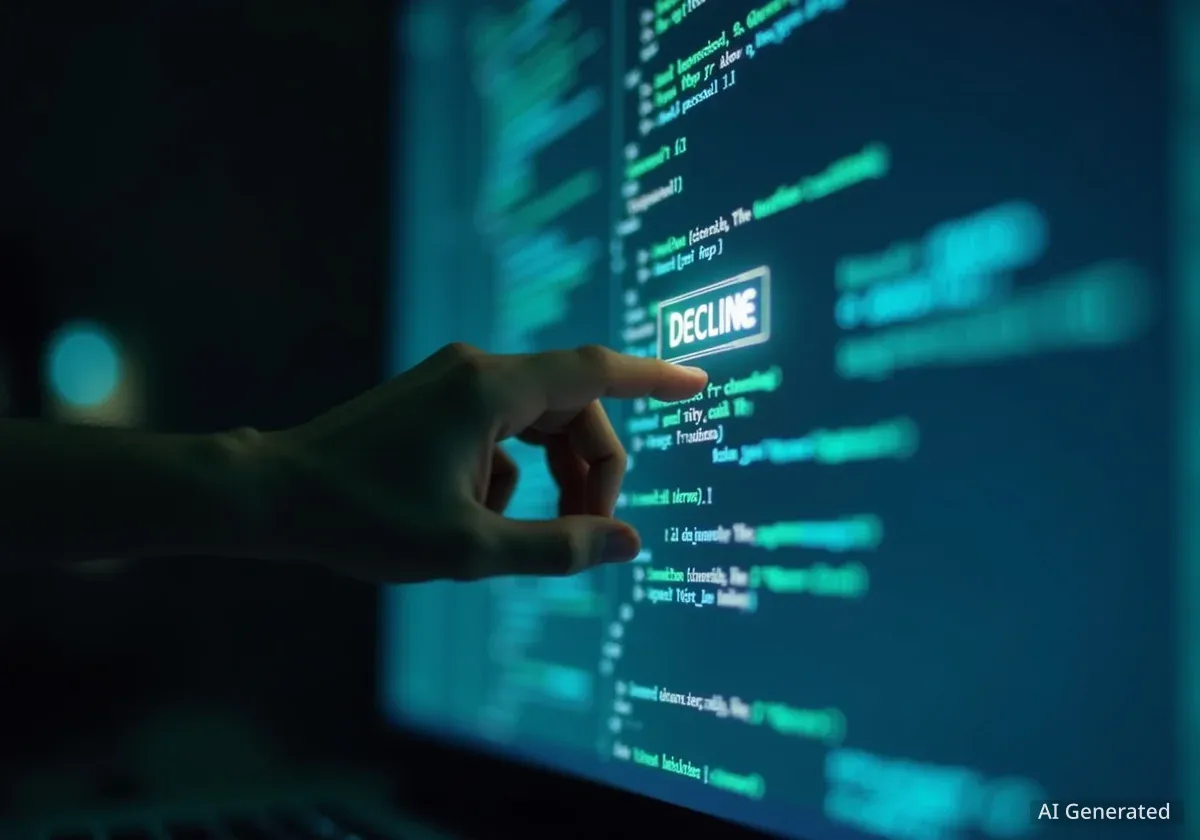Viele Nachrichten-Websites und Online-Dienste in Deutschland bieten ihre Inhalte scheinbar kostenlos an. Doch hinter dem freien Zugang verbirgt sich oft ein Geschäftsmodell, bei dem Nutzer nicht mit Geld, sondern mit ihren persönlichen Daten bezahlen. Dieses Modell, bekannt als „Leistung gegen Daten“, ist weit verbreitet und wirft wichtige Fragen zum Datenschutz und zur digitalen Privatsphäre auf.
Das Wichtigste in Kürze
- Viele kostenlose Online-Angebote werden durch die Sammlung und Nutzung von Nutzerdaten finanziert.
- Beim „Bezahlen mit Daten“ stimmen Nutzer der Verfolgung ihres Online-Verhaltens für personalisierte Werbung zu.
- Gesammelt werden unter anderem Cookies, Geräte-IDs und Informationen über besuchte Seiten und geklickte Links.
- Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen, erfordert aber die informierte Einwilligung der Nutzer.
- Verbraucher sollten sich der Risiken bewusst sein und haben oft die Wahl zwischen Datenfreigabe und einem kostenpflichtigen Abonnement.
Das Modell „Leistung gegen Daten“ einfach erklärt
Das Prinzip „Leistung gegen Daten“ ist ein Tauschgeschäft. Ein Unternehmen stellt einen digitalen Dienst zur Verfügung, zum Beispiel den Zugang zu journalistischen Artikeln, Social-Media-Plattformen oder kostenlosen Apps. Als Gegenleistung erteilt der Nutzer die Erlaubnis, dass seine Daten gesammelt und für kommerzielle Zwecke, hauptsächlich für personalisierte Werbung, verwendet werden dürfen.
Diese Praxis ist die Grundlage des Geschäftsmodells vieler großer Technologieunternehmen und Medienhäuser. Ohne die Einnahmen aus gezielter Werbung wäre es für viele Anbieter schwierig, ihre Dienste kostenfrei anzubieten. Für den Nutzer bedeutet dies eine Abwägung: Ist der kostenlose Zugang den Preis der eigenen Daten wert?
Hintergrund: Die Finanzierung von Online-Journalismus
Traditionelle Zeitungen finanzierten sich durch Verkaufspreise und Anzeigen. Im digitalen Zeitalter ist die Zahlungsbereitschaft für Online-Nachrichten geringer. Daher sind viele Verlage auf Werbeeinnahmen angewiesen, die durch personalisierte Anzeigen deutlich höher ausfallen als durch allgemeine Werbung.
Welche Daten werden gesammelt und wofür?
Wenn Nutzer dem Tracking zustimmen, erlauben sie die Erfassung einer Vielzahl von Informationen. Diese Daten geben ein detailliertes Bild über die Interessen, Gewohnheiten und sogar die Persönlichkeit einer Person ab. Die Sammlung erfolgt meist automatisiert im Hintergrund.
Typische erfasste Datenpunkte
Die gesammelten Informationen sind vielfältig und technisch. Zu den häufigsten gehören:
- Cookies: Kleine Textdateien, die auf dem Gerät des Nutzers gespeichert werden und ihn bei einem erneuten Besuch wiedererkennen.
- Geräte-IDs: Eindeutige Kennungen von Smartphones oder Tablets, die ein geräteübergreifendes Tracking ermöglichen.
- IP-Adresse: Sie verrät den ungefähren Standort des Nutzers.
- Browser-Verlauf: Welche Artikel gelesen, welche Videos angesehen und welche Produkte angeklickt wurden.
- Interaktionsdaten: Wie lange ein Nutzer auf einer Seite verweilt oder wie weit er nach unten scrollt.
Der Zweck der Datensammlung
Die gesammelten Daten werden primär für drei Zwecke genutzt:
- Gezielte Werbung: Werbetreibende können ihre Anzeigen sehr präzise an Nutzer ausspielen, die wahrscheinlich an ihren Produkten interessiert sind. Dies erhöht die Effektivität von Werbekampagnen erheblich.
- Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit: Anbieter analysieren das Verhalten, um ihre Webseiten und Apps zu optimieren und nutzerfreundlicher zu gestalten.
- Produktentwicklung: Aus den gewonnenen Erkenntnissen können neue digitale Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden, die auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind.
Wussten Sie schon?
Ein aus den gesammelten Daten erstelltes Nutzerprofil kann dutzende oder sogar hunderte von Merkmalen umfassen, darunter Alter, Geschlecht, Interessen, Kaufkraft und politische Neigungen. Diese Profile werden oft an Datenhändler verkauft und weiter angereichert.
Die rechtliche Grundlage: Was sagt die DSGVO?
Seit 2018 regelt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) den Umgang mit personenbezogenen Daten in der Europäischen Union. Das Modell „Leistung gegen Daten“ ist unter der DSGVO grundsätzlich erlaubt, allerdings an strenge Bedingungen geknüpft.
Die wichtigste Voraussetzung ist die freiwillige, informierte und eindeutige Einwilligung des Nutzers. Das bedeutet, Cookie-Banner dürfen nicht manipulativ gestaltet sein („Dark Patterns“) und müssen eine einfache Möglichkeit bieten, die Zustimmung zu verweigern.
„Die Einwilligung muss eine echte Wahlmöglichkeit bieten. Wenn die einzige Alternative zu einem umfassenden Tracking ein kostenpflichtiges Abonnement ist, muss diese Alternative fair und angemessen sein“, erklärt ein Sprecher einer Verbraucherzentrale.
Datenübermittlung in Drittländer
Ein besonders kritischer Punkt ist die Übermittlung von Daten in Länder außerhalb der EU, wie zum Beispiel die USA. Gemäß Art. 49 DSGVO ist dies zulässig, wenn es zur Erfüllung eines Vertrags notwendig ist. Viele Anbieter stützen sich auf diese Klausel, wenn sie die Daten ihrer Nutzer an US-amerikanische Werbenetzwerke weitergeben.
Datenschützer kritisieren diese Praxis, da das Datenschutzniveau in vielen Drittländern nicht dem der EU entspricht. Dies birgt das Risiko, dass europäische Bürger die Kontrolle über ihre Daten verlieren könnten.
Risiken und was Verbraucher beachten sollten
Auch wenn das Bezahlen mit Daten bequem erscheint, birgt es Risiken. Die umfassende Sammlung von Verhaltensdaten schafft transparente Bürger, deren Vorlieben und Schwächen für kommerzielle oder sogar politische Zwecke ausgenutzt werden können.
Worauf Sie achten sollten
- Lesen Sie die Datenschutzhinweise: Auch wenn es mühsam ist, geben die Hinweise Aufschluss darüber, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden.
- Treffen Sie eine bewusste Entscheidung bei Cookie-Bannern: Klicken Sie nicht einfach auf „Alles akzeptieren“. Prüfen Sie die Optionen und stimmen Sie nur dem Notwendigsten zu.
- Nutzen Sie Browser-Einstellungen: Moderne Browser bieten umfangreiche Möglichkeiten, Tracking zu unterbinden oder Cookies nach jeder Sitzung automatisch zu löschen.
- Prüfen Sie Alternativen: Viele Anbieter bieten neben dem datenbasierten Modell auch ein werbe- und trackingfreies Abonnement an.
Letztlich ist es eine persönliche Entscheidung. Der digitale Raum bietet enorme Möglichkeiten, aber es ist wichtig, die Mechanismen dahinter zu verstehen. Nur so können Nutzer souverän entscheiden, welchen Preis sie für „kostenlose“ Inhalte zu zahlen bereit sind.