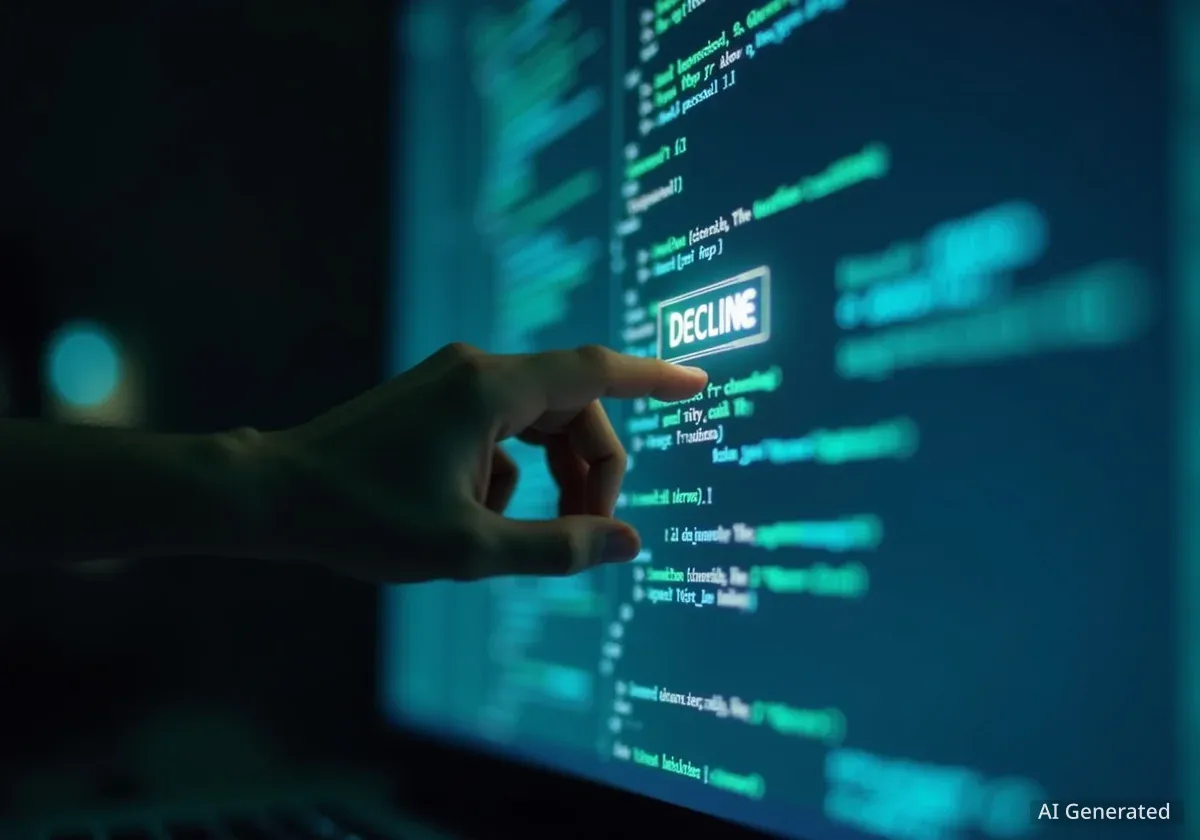Besucher von Online-Nachrichtenseiten in Köln und ganz Deutschland stehen oft vor der Wahl: ein Abonnement abschließen oder der Nutzung ihrer Daten zustimmen. Dieses Modell, bekannt als „Bezahlen mit Daten“, ist eine gängige Methode zur Finanzierung von Journalismus. Doch viele Nutzer sind unsicher, was genau hinter den Cookie-Bannern passiert und welche rechtlichen Grundlagen gelten.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) regelt klar, wie Unternehmen personenbezogene Daten verarbeiten dürfen. Für die Online-Medienbranche stellt sie die Weichen für Geschäftsmodelle, die auf nutzerbasierter Werbung aufbauen und gleichzeitig die Rechte der Verbraucher wahren sollen.
Wichtige Erkenntnisse
- Viele Online-Nachrichtenseiten finanzieren sich durch ein „Bezahlen mit Daten“-Modell als Alternative zu kostenpflichtigen Abonnements.
- Grundlage ist ein Tauschgeschäft: Nutzer erhalten kostenlosen Zugang zu Inhalten und stimmen im Gegenzug der Verarbeitung ihrer Daten für Werbezwecke zu.
- Die rechtliche Basis dafür liefert die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere Artikel 6.
- Technologien wie Cookies und Geräte-IDs werden genutzt, um das Verhalten der Nutzer zu analysieren und personalisierte Werbung auszuspielen.
- Daten können unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen auch an Partner in Länder außerhalb der EU übermittelt werden.
Die Finanzierung von Online-Journalismus
Qualitativ hochwertiger Journalismus erfordert erhebliche Ressourcen. Redaktionen müssen Reporter, Redakteure, technische Infrastruktur und Vertrieb finanzieren. Im digitalen Zeitalter ist das traditionelle Geschäftsmodell aus Anzeigen- und Verkaufserlösen unter Druck geraten, da viele Nutzer kostenlose Inhalte im Internet erwarten.
Um weiterhin unabhängige Berichterstattung anbieten zu können, haben viele Verlage neue Wege der Finanzierung entwickelt. Eine der verbreitetsten Methoden ist das sogenannte Freemium-Modell, bei dem Nutzer die Wahl haben: Entweder sie schließen ein kostenpflichtiges Abonnement ab oder sie stimmen der Nutzung ihrer Daten zu.
Was bedeutet „Bezahlen mit Daten“?
Das Prinzip „Bezahlen mit Daten“ ist im Grunde ein Tauschgeschäft. Der Nutzer bezahlt nicht mit Geld, sondern mit der Erlaubnis, dass seine personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke, vor allem für personalisierte Werbung, verarbeitet werden dürfen. Diese Daten sind für Werbetreibende wertvoll, da sie es ermöglichen, Anzeigen gezielter an potenzielle Kunden auszuspielen.
Die Einnahmen aus dieser nutzerbasierten Werbung helfen den Verlagen, ihre Kosten zu decken und die journalistischen Inhalte weiterhin einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Die rechtlichen Grundlagen nach der DSGVO
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in der Europäischen Union streng geregelt. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), in Deutschland oft als DSGVO bezeichnet, bildet den zentralen rechtlichen Rahmen. Sie legt fest, dass für jede Datenverarbeitung eine gültige Rechtsgrundlage erforderlich ist.
Was ist die DSGVO?
Die Datenschutz-Grundverordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, die seit Mai 2018 in allen Mitgliedstaaten gilt. Ihr Ziel ist es, die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen zu schützen, insbesondere ihr Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Sie standardisiert die Regeln für die Verarbeitung von Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen in der EU.
Im Fall des „Bezahlen mit Daten“-Modells stützen sich viele Anbieter auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO. Dieser Artikel erlaubt die Datenverarbeitung, wenn sie „für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist“.
Hier wird der Zugang zu den journalistischen Inhalten als eine vertragliche Leistung angesehen, für die der Nutzer im Gegenzug seine Daten zur Verfügung stellt. Deutsche Gesetze, wie die Paragrafen 312 und 327 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), ergänzen diese Regelung und schaffen eine Grundlage für sogenannte „digitale Dienstleistungen gegen Daten“.
Welche Daten werden erfasst und wie?
Wenn ein Nutzer der Datenverarbeitung zustimmt, werden verschiedene Technologien eingesetzt, um Informationen über sein Verhalten zu sammeln. Diese Technologien helfen dabei, ein anonymisiertes oder pseudonymisiertes Profil zu erstellen, das für die Ausspielung relevanter Werbung genutzt wird.
- Cookies: Kleine Textdateien, die auf dem Gerät des Nutzers gespeichert werden und Informationen über besuchte Seiten oder Klickverhalten enthalten.
- Geräte-IDs: Eindeutige Kennungen für Smartphones oder Tablets, die eine Wiedererkennung des Geräts ermöglichen.
- Tracking-Technologien: Skripte und Pixel, die auf der Webseite eingebettet sind und die Interaktionen des Nutzers aufzeichnen.
Die gesammelten Daten umfassen typischerweise Informationen darüber, welche Artikel gelesen werden, wie lange ein Nutzer auf einer Seite verweilt und für welche Themen er sich interessiert. Demografische Merkmale wie Alter oder Geschlecht werden oft nur geschätzt und nicht direkt abgefragt.
Zweck der Datenerfassung
Die aus der Nutzung gewonnenen Erkenntnisse dienen laut den Anbietern mehreren Zielen: Sie ermöglichen die gezielte Ausspielung von Anzeigen und Inhalten, helfen bei der Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Webseite und unterstützen die Entwicklung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen.
Datenübermittlung in Drittländer
Ein wichtiger Aspekt, über den Nutzer informiert werden müssen, ist die mögliche Übermittlung von Daten an Partner, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben. Solche Länder werden als „Drittländer“ bezeichnet und verfügen möglicherweise nicht über ein Datenschutzniveau, das mit dem der EU vergleichbar ist.
Die DSGVO sieht auch hierfür spezielle Regelungen vor. Eine Datenübermittlung in ein Drittland kann auf Grundlage von Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO stattfinden. Diese Vorschrift erlaubt die Übermittlung, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Nutzer und dem Anbieter erforderlich ist.
„Die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich.“ - Auszug aus Art. 49 DSGVO
Das bedeutet konkret: Wenn ein internationaler Werbepartner für die Finanzierung des Dienstes notwendig ist, kann die Übermittlung der Nutzerdaten an diesen Partner unter dieser Ausnahmeregelung gerechtfertigt sein. Nutzer müssen über diesen Umstand transparent informiert werden.
Rechte der Nutzer und Transparenz
Die DSGVO stärkt die Rechte der Verbraucher erheblich. Jeder Nutzer hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten. Zudem müssen Unternehmen eine klare und verständliche Datenschutzerklärung bereitstellen, die über alle Aspekte der Datenverarbeitung aufklärt.
Dazu gehört auch eine sogenannte Widerrufsbelehrung. Nutzer, die ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung gegeben haben, müssen die Möglichkeit haben, diese jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Ein solcher Widerruf führt in der Regel dazu, dass der Zugang zu den kostenlosen Inhalten nicht mehr möglich ist und der Nutzer auf ein Bezahlmodell ausweichen muss.
Die Debatte über das „Bezahlen mit Daten“ bleibt komplex. Während es Verlagen ermöglicht, ihre Arbeit zu finanzieren, wirft es gleichzeitig Fragen zum Wert der Privatsphäre und zur Datensouveränität der Nutzer auf. Eine informierte Entscheidung auf Basis transparenter Informationen ist daher für jeden Einzelnen von entscheidender Bedeutung.