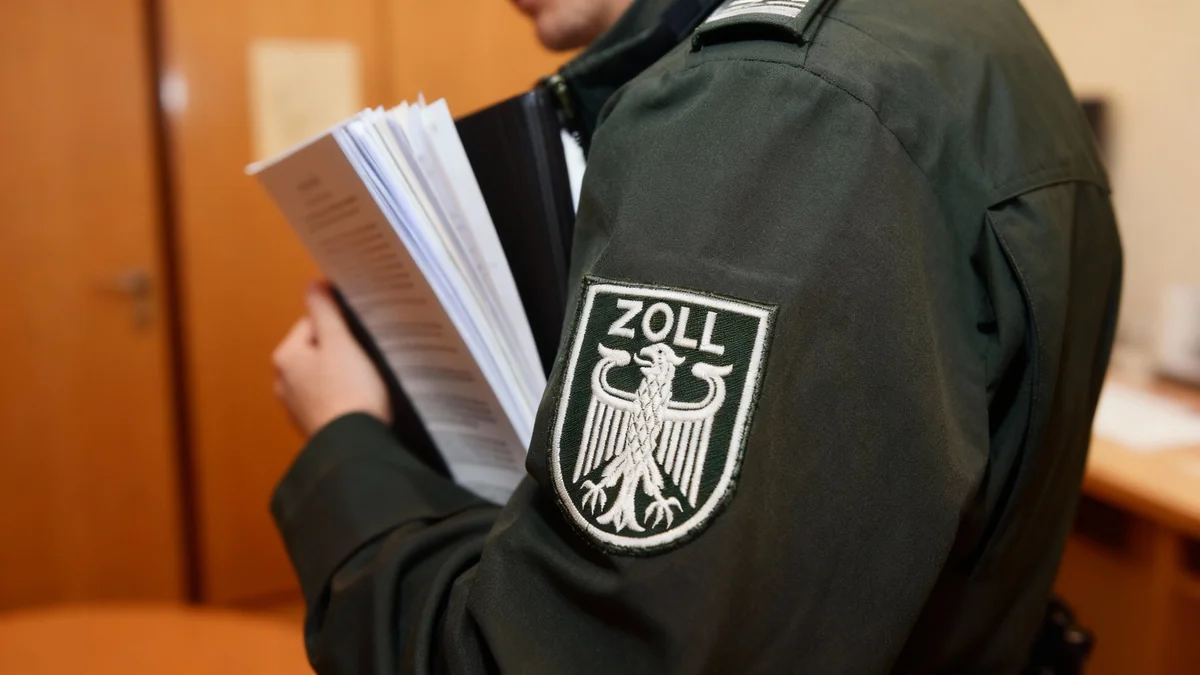An der Uniklinik Köln hat die erste Patientin eine Behandlung mit dem neuen Alzheimer-Medikament Lecanemab erhalten. Der Wirkstoff, der seit Anfang September in Deutschland zugelassen ist, soll den Krankheitsverlauf bei Patienten im Frühstadium verlangsamen. Für die 74-jährige Betroffene stellt die Therapie einen Hoffnungsschimmer dar.
Wichtige Fakten
- Lecanemab ist ein neuer Antikörper zur Behandlung von Alzheimer im Frühstadium.
- Die Uniklinik Köln behandelt damit die erste Patientin in der Stadt.
- Das Medikament entfernt Eiweißablagerungen im Gehirn, sogenannte Beta-Amyloid-Plaques.
- Studien zeigen, dass Lecanemab den geistigen Abbau um etwa ein Drittel verlangsamen kann.
- Die Therapie ist nur für eine kleine Gruppe von Patienten geeignet, deren Erkrankung früh erkannt wurde.
Ein Neustart im Kampf gegen das Vergessen
Für Luise, deren Name zum Schutz ihrer Privatsphäre geändert wurde, war der 9. September ein besonderer Tag. An diesem Datum erhielt die 74-Jährige als erste Patientin an der Uniklinik Köln ihre erste Infusion mit Lecanemab. „Es fühlt sich an wie ein Neustart“, beschreibt sie den Moment. Die Behandlung, die alle zwei Wochen wiederholt wird, soll die fortschreitende Zerstörung von Nervenzellen in ihrem Gehirn aufhalten.
Ihre Alzheimer-Diagnose erhielt sie vor drei Jahren eher zufällig. Sie hatte sich für eine Studie an der Uniklinik gemeldet, da ihre Mutter ebenfalls an Demenz erkrankt war und sie die Forschung unterstützen wollte. Bei den Untersuchungen entdeckten die Ärzte erste Anzeichen der Krankheit bei ihr selbst. Die Symptome waren subtil: Sie verlor den Überblick über die Wochentage, machte Fehler bei Bankgeschäften und wurde lärmempfindlicher.
„Wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig beachten muss, spüre ich das richtig im Kopf“, erklärt Luise. „Auch längere Autofahrten strengen mich sehr an.“ Trotz dieser Einschränkungen führt sie ein aktives Leben, was laut Experten den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann.
Wie Lecanemab im Gehirn wirkt
Die Alzheimer-Krankheit wird durch die Ansammlung von schädlichen Eiweißablagerungen im Gehirn verursacht, den sogenannten Beta-Amyloid-Plaques. Professor Özgür Onur, der Luise an der Uniklinik Köln betreut, vergleicht diesen Prozess mit Müll, der sich am Straßenrand ansammelt und nicht abgeholt wird. „Diese Plaques stören die Kommunikation zwischen den Nervenzellen, was letztendlich zu deren Absterben führt“, so Onur.
Was ist Lecanemab?
Lecanemab ist ein monoklonaler Antikörper. Das bedeutet, er ist darauf programmiert, gezielt die Beta-Amyloid-Proteine zu erkennen und zu binden. Dadurch markiert er die schädlichen Ablagerungen für das Immunsystem des Körpers, welches die Plaques anschließend abbauen und entfernen kann. Dieser Prozess soll das Gehirn von den schädlichen Eiweißen „säubern“.
Lecanemab greift genau hier an. Der Antikörper hilft dem Körper, diese Müllberge im Gehirn zu beseitigen. Klinische Studien haben gezeigt, dass das Medikament die Plaques effektiv, manchmal sogar vollständig, entfernen kann. Das Ziel ist es, das Umfeld für die verbliebenen Nervenzellen zu verbessern und ihr weiteres Absterben zu verlangsamen.
Eine Bremse, keine Heilung
Professor Onur betont jedoch die Grenzen der Behandlung. „Lecanemab heilt die Krankheit nicht. Einmal abgestorbene Nervenzellen können nicht wiederhergestellt werden“, stellt er klar. Das Medikament wirke vielmehr wie eine Bremse für den Krankheitsverlauf. „Wir verlangsamen das Fortschreiten um etwa ein Drittel“, erklärt der Mediziner. Das bedeutet, ein Patient erreicht den Zustand, den er ohne Behandlung in einem Jahr hätte, mit dem Medikament erst nach etwa 18 Monaten.
Für Luise sind das „geschenkte Tage“. Sie ist sich bewusst, dass ihre Hoffnungen realistisch bleiben müssen. „Es ist eine Chance, aber ich darf das auch nicht zu hoch hängen“, sagt sie. Dennoch gibt ihr die Therapie die Zuversicht, mehr wertvolle Zeit zu gewinnen.
Strenge Kriterien für die neue Therapie
Die Behandlung mit Lecanemab kommt nicht für jeden Alzheimer-Patienten in Frage. Die Kriterien sind streng und begrenzen den Kreis der geeigneten Personen erheblich. Professor Onur schätzt, dass in Köln nur einige hundert Patienten die Voraussetzungen erfüllen könnten. An der Uniklinik sollen in den kommenden Wochen etwa 50 von ihnen mit der Therapie beginnen.
Die wichtigsten Voraussetzungen sind:
- Frühes Krankheitsstadium: Die Diagnose muss gestellt werden, bevor signifikante Alltagsbeeinträchtigungen auftreten. Man spricht in diesem Stadium noch nicht von einer Demenz.
- Körperliche Gesundheit: Patienten müssen körperlich fit sein, um das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.
- Nachweis von Amyloid-Plaques: Die Anwesenheit der Eiweißablagerungen muss durch eine Untersuchung des Nervenwassers (Lumbalpunktion) oder eine spezielle Bildgebung (PET-Scan) bestätigt werden.
Luise erfüllt all diese Kriterien. Ihre Krankheit wurde früh erkannt, und sie ist körperlich gesund. Das macht sie zur idealen Kandidatin für den neuen Behandlungsansatz.
Leben mit der Diagnose
Obwohl Luise noch nicht als dement gilt, da sie ihren Alltag weitgehend selbst bewältigen kann, spürt sie die kognitiven Lücken. Termine muss nun auch ihre Partnerin Brigitte notieren, um sicherzugehen, dass nichts vergessen wird. Die Verantwortung abzugeben, fällt der sonst sehr selbstständigen Frau nicht leicht.
Die Bedeutung eines aktiven Lebensstils
Professor Onur lobt Luises Umgang mit ihrer Erkrankung. Sie malt, fährt Rad, spielt Tischtennis und jongliert. Diese Kombination aus geistiger und körperlicher Aktivität ist laut dem Experten ein wichtiger Schutzfaktor für das Gehirn. „Spazierengehen ist gut, aber Tischtennisspielen ist besser, weil es Bewegung und Gehirnaktivität verbindet“, so Onur.
„Niemand muss eine Sprache lernen, wenn er darauf keine Lust hat. Der Schlüssel zum Erfolg ist der Spaß an der Aktivität.“
Luises proaktive Haltung hat wahrscheinlich schon vor der medikamentösen Behandlung dazu beigetragen, den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen. Die Diagnose hat paradoxerweise auch positive Veränderungen in ihrem Leben bewirkt. „Früher litt ich an Winterdepression. Heute hat sich Akzeptanz eingestellt. Ich bin dankbar für jeden Tag“, erzählt sie. Die Angst vor der Zukunft ist zwar präsent, doch sie lässt ihr Leben nicht davon überschatten.
Mit der neuen Therapie verbindet sie die Hoffnung, dass die Forschung weitere Fortschritte macht. Die gewonnenen Monate und Jahre könnten ihr die Chance geben, von zukünftigen, noch wirksameren Medikamenten zu profitieren. Für sie und viele andere Betroffene ist Lecanemab ein wichtiger erster Schritt in eine hoffnungsvollere Zukunft.