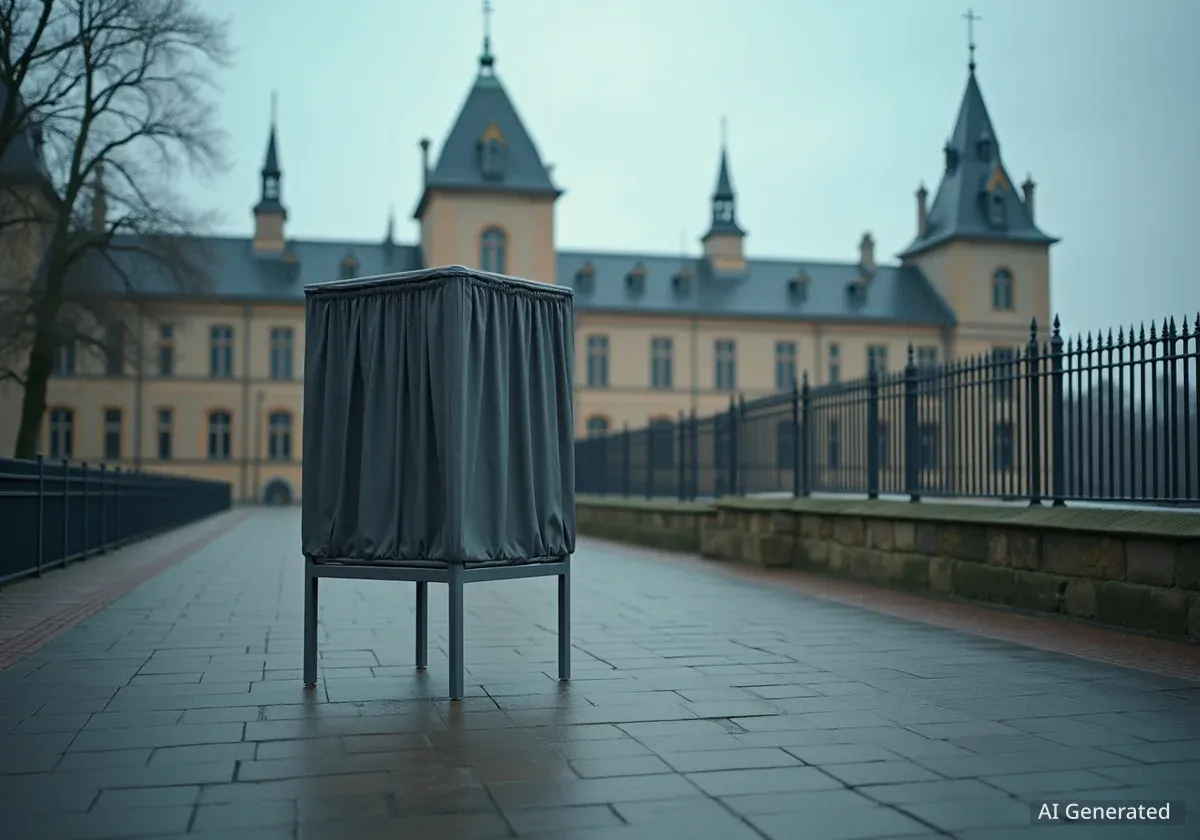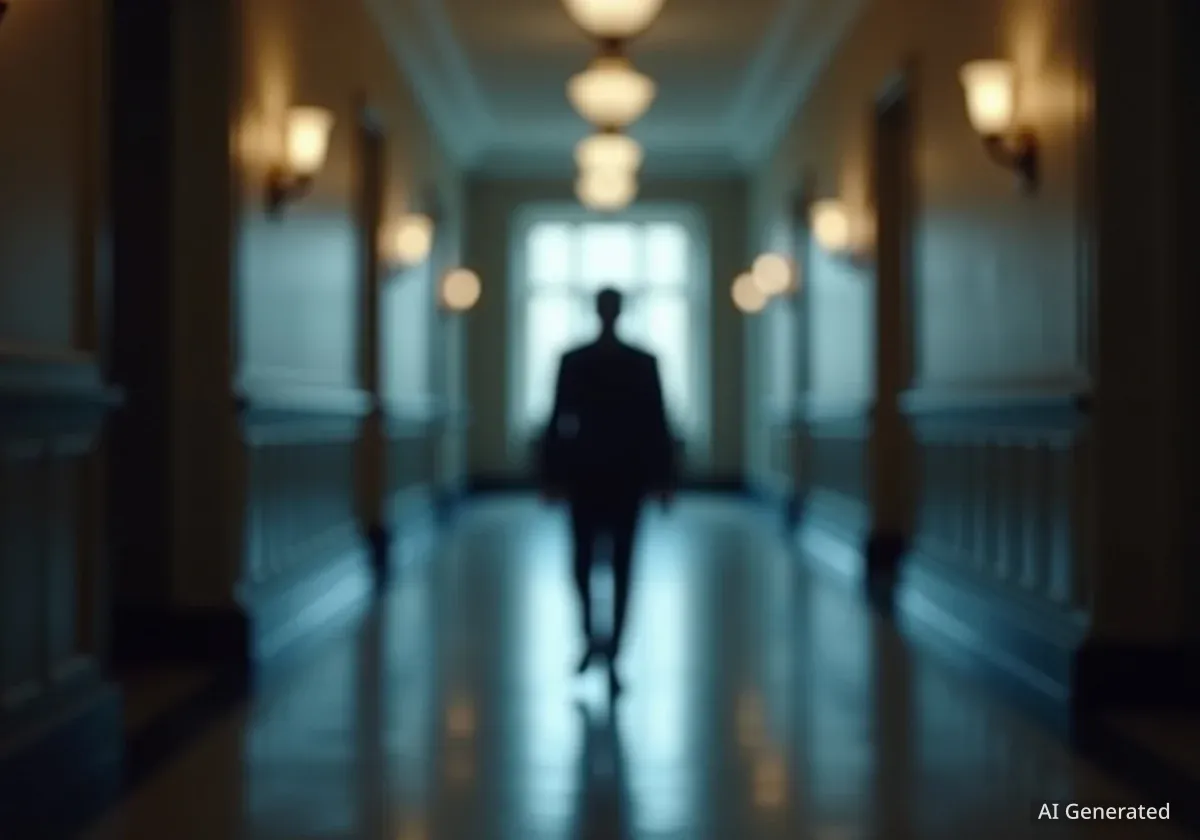In Syrien finden an diesem Sonntag die ersten Parlamentswahlen seit dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad statt. Der Urnengang soll den Beginn einer neuen demokratischen Ära markieren. Doch das gewählte Verfahren, eine indirekte Wahl, sowie der große Einfluss des De-facto-Machthabers Ahmed al-Scharaa sorgen für massive Kritik von Aktivisten und Menschenrechtsorganisationen, die den Prozess als undemokratisch bezeichnen.
Wichtige Fakten
- In Syrien wird zum ersten Mal seit dem Ende der Assad-Diktatur ein Übergangsparlament gewählt.
- Das Wahlsystem ist indirekt: Bürger wählen nicht direkt, sondern über ernannte Wahlgremien.
- Der Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa ernennt ein Drittel der Abgeordneten und besitzt ein Vetorecht.
- Aktivisten und zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren das Verfahren als undemokratisch und mangelhaft.
- Wahlen in wichtigen Regionen im Norden und Süden des Landes wurden ausgesetzt, was den Prozess weiter untergräbt.
Ein umstrittener Neuanfang für Syrien
Fast ein Jahr nach dem Ende der über 50-jährigen Diktatur unter der Assad-Familie am 8. Dezember 2024 geht Syrien einen entscheidenden Schritt in seiner politischen Neuordnung. Die Wahl einer neuen Volksversammlung soll das Land auf den Weg in eine demokratische Zukunft führen. Doch die Hoffnungen vieler Syrer werden bereits im Vorfeld gedämpft.
Anstelle eines direkten Wahlkampfes mit konkurrierenden Parteien findet ein komplexes, indirektes Wahlverfahren statt. Die Übergangsregierung in Damaskus argumentiert, dass die aktuelle Lage im Land, mit Millionen von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen im Ausland, keine herkömmlichen Wahlen zulasse. Viele Menschen besäßen keine gültigen Dokumente, und die rechtlichen Strukturen seien noch zu schwach.
Hintergrund: Der syrische Bürgerkrieg
Vor mehr als vierzehn Jahren begannen Massenproteste gegen das Regime von Baschar al-Assad, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Der daraus resultierende Bürgerkrieg führte zu hunderttausenden Toten, massiver Zerstörung und einer der größten Flüchtlingskrisen der modernen Geschichte. Der Sturz des Regimes im Dezember 2024 beendete den Konflikt, hinterließ aber ein politisch und gesellschaftlich zerrüttetes Land.
Kritik von Aktivisten: "Ein schlecht inszeniertes Theaterstück"
Für viele, die jahrelang für Demokratie gekämpft haben, ist der aktuelle Wahlprozess eine Enttäuschung. Moutasem Alrifai, ein 27-jähriger Menschenrechtsaktivist aus Daraa, der Wiege der Revolution, hatte nach Assads Sturz neue Hoffnung geschöpft. Doch die jetzigen Wahlen entsprechen nicht seinen Vorstellungen von einem demokratischen Wandel.
„Was in Syrien stattfindet, ist keine Wahl, sondern ein schlecht inszeniertes Theaterstück, das das Publikum für dumm verkauft“, sagte Alrifai in einem Gespräch.
Seine Kritik richtet sich vor allem an die Struktur des Wahlverfahrens, das die Macht in den Händen der neuen Führung konzentriert und eine echte politische Teilhabe der Bevölkerung verhindert.
Das Wahlsystem im Detail
Das neue Übergangsparlament wird von 150 auf 210 Sitze vergrößert. Die Besetzung dieser Sitze erfolgt jedoch nur zu einem kleinen Teil durch einen demokratisch anmutenden Prozess. Die Struktur ist mehrstufig und komplex.
Die Ernennung der Wahlgremien
Eine elfköpfige Oberste Wahlkommission, die vom De-facto-Machthaber Ahmed al-Scharaa ernannt wurde, bildet die Spitze des Systems. Diese Kommission benennt in den einzelnen Wahlkreisen Unterausschüsse. Diese Unterausschüsse wiederum ernennen ein sogenanntes Wahlkollegium mit bis zu 50 Mitgliedern pro Kreis.
Laut offiziellen Angaben sollen mindestens 20 Prozent der Mitglieder dieser Gremien Frauen sein, um eine gewisse Vielfalt zu gewährleisten. Mohammad Wali, ein Mitglied der Wahlkommission, bezeichnete das System als ein „für Syrien einzigartiges Modell“, das an die besonderen Umstände der Übergangsphase angepasst sei.
Die Machtverteilung im neuen Parlament
Von den 210 Abgeordneten werden 140 Mitglieder von den zuvor ernannten Wahlkollegien aus ihren eigenen Reihen gewählt. Die restlichen 70 Abgeordneten, also ein Drittel des gesamten Parlaments, werden direkt von Übergangspräsident al-Scharaa ernannt.
Vetorecht sichert die Macht
Ahmed al-Scharaa verfügt über ein Vetorecht gegen jedes Gesetz, das die neue Volksversammlung verabschiedet. Um dieses Veto zu überstimmen, ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig. Da al-Scharaa bereits ein Drittel der Abgeordneten selbst ernennt, benötigt er nur eine einzige zusätzliche Stimme aus dem gewählten Teil des Parlaments, um jedes unliebsame Gesetz zu blockieren.
Aktivist Alrifai sieht darin die Schaffung eines reinen „Applaus-Parlaments“. Seiner Meinung nach wird die Versammlung keine Kontrollfunktion ausüben, sondern lediglich die Entscheidungen der Exekutive bestätigen. Zudem hat das Parlament keine Befugnis, den Präsidenten oder seine Minister zur Rechenschaft zu ziehen.
Ausschluss ganzer Regionen
Die Legitimität der Wahlen wird zusätzlich durch den Ausschluss wichtiger Landesteile geschwächt. Ursprünglich für Mitte September geplant, wurden die Wahlen in den Provinzen Suwaida im Süden sowie Hasaka und Rakka im Nordosten auf unbestimmte Zeit verschoben. Offiziell wurden Sicherheitsbedenken als Grund genannt, da es in diesen Gebieten zuletzt bewaffnete Auseinandersetzungen gab.
Kritiker sehen darin jedoch eine politische Entscheidung. Diese Regionen werden nicht von der Übergangsregierung in Damaskus kontrolliert, sondern von drusischen und kurdischen Kräften verwaltet. Die kurdisch geführte Selbstverwaltung im Nordosten Syriens hat bereits angekündigt, die Wahlen abzulehnen, da sie „nicht den Willen des syrischen Volkes widerspiegeln“.
Odai, ein Aktivist aus Suwaida, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte, bezeichnet den Ausschluss seiner Heimatregion als „kollektive Bestrafung“. Er argumentiert, dass fast die Hälfte der syrischen Bevölkerung von diesem politischen Prozess ausgeschlossen wird.
„Richtige Wahlen brauchen ein sicheres und freies Umfeld: unabhängige Parteien, freie Medien, Kontrolle und die Möglichkeit, dass Menschen kandidieren und kritisieren können, ohne Angst zu haben“, so Odai.
Internationale Kritik und Forderungen
Die Bedenken werden von zahlreichen Organisationen geteilt. Mitte September veröffentlichten vierzehn syrische Menschenrechts- und zivilgesellschaftliche Organisationen eine gemeinsame Erklärung. Darin bezeichnen sie das Wahlsystem als „mit tiefgreifenden strukturellen Mängeln behaftet“, das die internationalen Mindeststandards für politische Teilhabe nicht erfülle.
Die Organisationen fordern unter anderem:
- Die Abschaffung der Regelung, dass der Übergangspräsident ein Drittel der Abgeordneten ernennt.
- Eine Umstrukturierung der Wahlgremien in enger Absprache mit der Zivilgesellschaft und allen politischen Kräften im Land.
Die Wahlen am Sonntag werden somit nicht als Aufbruch in eine demokratische Zukunft gefeiert, sondern von vielen Syrern und internationalen Beobachtern mit großer Skepsis betrachtet. Sie könnten die politischen Gräben im Land eher vertiefen als überwinden.