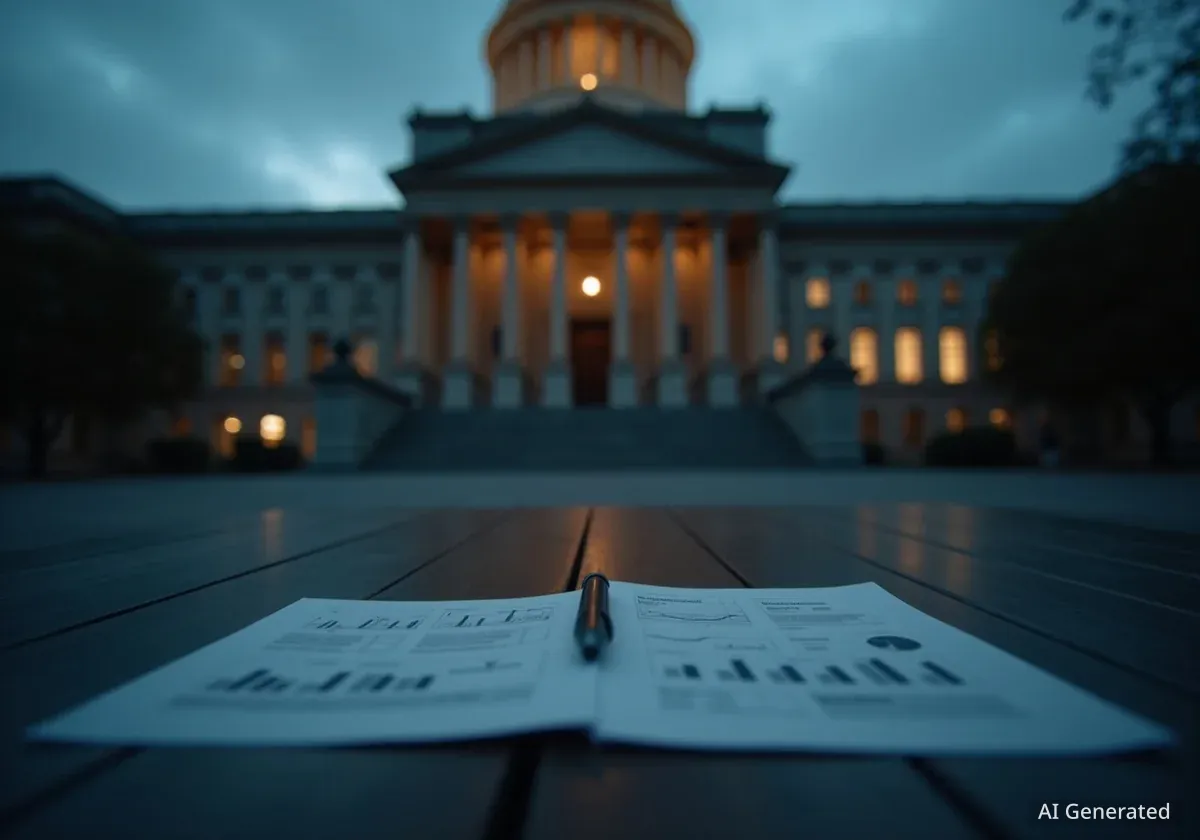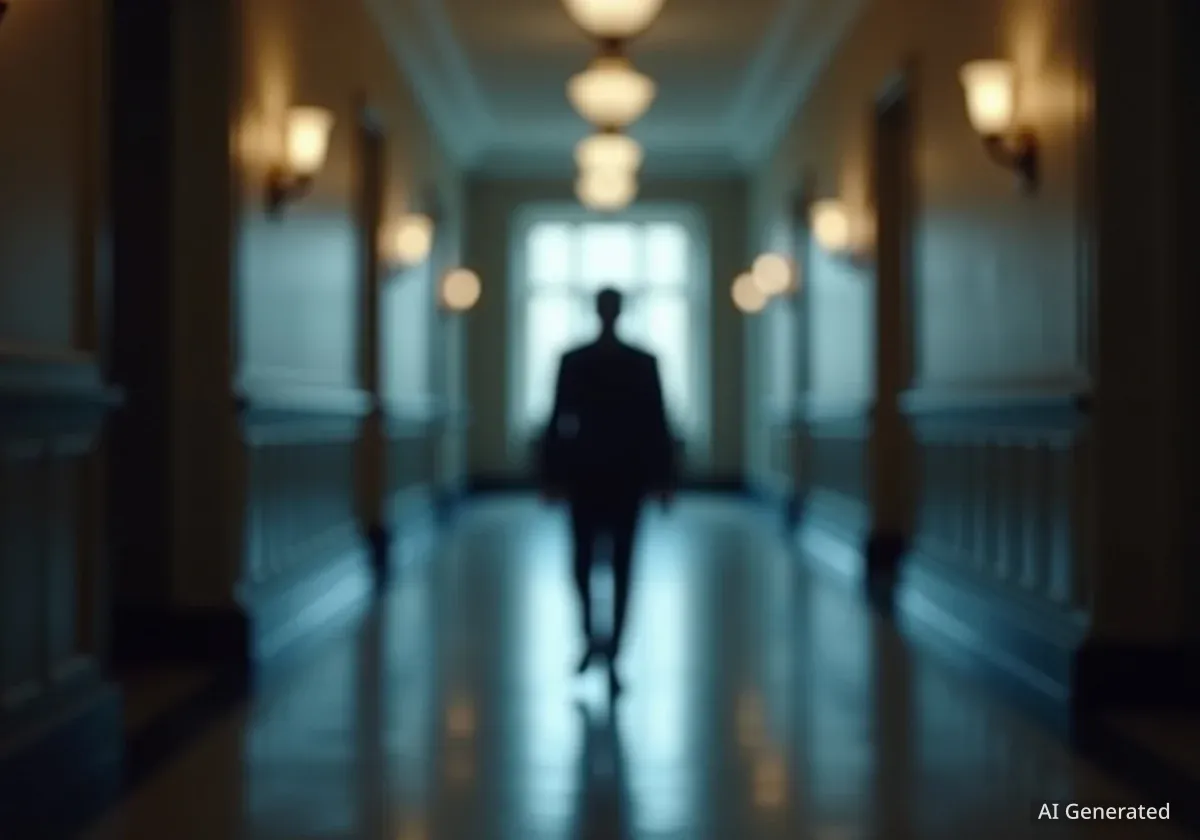Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln wirft der Bundesregierung vor, das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) zweckentfremdet zu haben. Anstatt zusätzliche Projekte zu finanzieren, würden damit Lücken im regulären Bundeshaushalt geschlossen. Eine Analyse des IW zeigt fünf konkrete Fälle auf, in denen Gelder verschoben und reguläre Haushaltsmittel gekürzt wurden.
Das Wichtigste in Kürze
- Vorwurf: Die Bundesregierung nutzt das Sondervermögen SVIK, um den regulären Haushalt zu entlasten, anstatt zusätzliche Investitionen zu tätigen.
- Quelle der Kritik: Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat fünf Fälle identifiziert, die diese Praxis belegen sollen.
- Betroffene Bereiche: Deutsche Bahn, Autobahnbrücken, Breitbandausbau, Krankenhäuser und der Klima- und Transformationsfonds (KTF).
- Reaktion der Regierung: Das Bundesfinanzministerium weist die Vorwürfe zurück und verweist auf gestiegene Gesamtinvestitionen sowie haushaltsrechtliche Vorgaben.
IW-Analyse deckt massive Umschichtungen auf
Das Sondervermögen wurde eingerichtet, um zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und den Klimaschutz zu ermöglichen. Die Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft legt jedoch nahe, dass dieses Prinzip der „Zusätzlichkeit“ in mehreren Fällen nicht eingehalten wird. Stattdessen werden Ausgaben aus dem Kernhaushalt in das Sondervermögen verlagert, wodurch im regulären Budget finanzielle Spielräume entstehen.
Diese Vorgehensweise steht im Zentrum der Kritik, da die über Kredite finanzierten Sondervermögen von zukünftigen Generationen zurückgezahlt werden müssen. Die IW-Ökonomen sehen darin eine Umgehung der Schuldenbremse und eine Verschleierung der wahren Haushaltslage.
Hintergrund: Das Sondervermögen SVIK
Das „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIK) wurde mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro aufgelegt. Es soll, getrennt vom regulären Bundeshaushalt, langfristige und zusätzliche Investitionen in Schlüsselbereiche wie Verkehr, digitale Infrastruktur und Klimaschutz sicherstellen. Das zentrale Versprechen war die „Zusätzlichkeit“ der Mittel, was bedeutet, dass bestehende Ausgaben nicht ersetzt, sondern ergänzt werden sollen.
Fünf Beispiele für die umstrittene Praxis
Die Studie des IW Köln listet fünf zentrale Bereiche auf, in denen die Regierung Gelder aus dem SVIK nutzt, während sie gleichzeitig die Mittel im regulären Haushalt kürzt. Dieses Muster wiederholt sich laut den Wirtschaftsforschern systematisch.
Fall 1: Deutsche Bahn
Der wohl gravierendste Fall betrifft die Deutsche Bahn. Für die Schieneninfrastruktur sind 18,8 Milliarden Euro aus dem SVIK vorgesehen. Gleichzeitig, so das IW, sinken die Investitionen für die Schiene im Bundeshaushalt um 13,7 Milliarden Euro. Nach Bereinigung um eine Eigenkapitalerhöhung der Bahn ergibt sich laut den Forschern eine Entlastung des Kernhaushalts von 8,2 Milliarden Euro.
Fall 2: Sanierung von Autobahnbrücken
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Bundesfernstraßen. Im Jahr 2026 sollen 2,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in die Sanierung von Autobahnbrücken fließen. Parallel dazu werden die Mittel für Bundesfernstraßen im Kernhaushalt jedoch um 1,7 Milliarden Euro im Vergleich zu 2024 reduziert. Statt eines Zuwachses findet also eine Verlagerung statt.
Verkehrsminister beklagt Finanzlücke
Trotz der hohen Summen im Sondervermögen beklagte Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) öffentlich eine Finanzlücke. Ihm fehlten bis 2029 insgesamt 15 Milliarden Euro, um fertig geplante Fernstraßenprojekte umzusetzen. Sein Ministeriumsetat sank von 44 Milliarden Euro im Vorjahr auf 38 Milliarden Euro in diesem Jahr.
Fall 3: Breitbandausbau
Besonders deutlich wird die Umschichtung laut IW beim Breitbandausbau. Dieser Posten war 2024 noch mit 1,8 Milliarden Euro im regulären Haushalt verankert. Für das Jahr 2026 taucht er nun mit 2,3 Milliarden Euro im SVIK auf, während er aus dem Kernhaushalt vollständig verschwunden ist.
Fall 4: Krankenhausfinanzierung
Auch das Gesundheitswesen ist betroffen. Sechs Milliarden Euro für Krankenhäuser, die ursprünglich aus dem Gesundheitsfonds und von den Ländern finanziert werden sollten, finden sich nun im SVIK wieder. Dies entlastet die eigentlich zuständigen Kostenträger direkt.
Fall 5: Klima- und Transformationsfonds (KTF)
Der KTF erhält ab 2025 jährlich zehn Milliarden Euro aus dem Sondervermögen. Die IW-Analyse kommt zu dem Schluss, dass diese Mittel kaum in zusätzliche Klimaschutzinvestitionen fließen. „Rechnerisch werden mit den Mitteln aus dem SVIK damit größtenteils keine zusätzlichen Investitionen in die Klimaneutralität finanziert“, heißt es in dem Bericht.
Finanzministerium verteidigt Vorgehen
Das Bundesfinanzministerium wies die Vorwürfe auf Anfrage zurück. Eine Sprecherin erklärte, dass die Gesamtinvestitionen im Bundeshaushalt 2026 auf einen Rekordwert von 126,7 Milliarden Euro steigen würden. Die Umschichtungen seien haushaltsrechtlich notwendig, da Ausgaben für denselben Zweck nicht an unterschiedlichen Stellen im Haushalt veranschlagt werden dürften.
Das Ministerium widersprach auch der Darstellung des IW bei den Verkehrsinvestitionen und sprach von einer Erhöhung der Mittel für Bundesfernstraßen. Bei der KTF-Finanzierung wurde auf Altlasten der Vorgängerregierung verwiesen. Die Zuweisung aus dem SVIK sei notwendig, um ungedeckte Ausgaben zu kompensieren. Die Krankenhausfinanzierung über das Sondervermögen diene dazu, einen Anstieg der Krankenkassenbeiträge abzufedern.
„Die Bundesregierung verspielt mit diesem Vorgehen viel Glaubwürdigkeit. Statt neuer Brücken finanziert Deutschland mit dem Sondervermögen jetzt auch die Mütterrente. Das ist ein schweres Foulspiel.“
- Tobias Hentze, IW-Haushaltsexperte
Kritik an der Finanzierungslogik
Experten kritisieren zudem die grundlegende Aufteilung der Finanzierung. Während Sanierungsprojekte, die dem Werterhalt dienen, nun über neue Kredite im Sondervermögen finanziert werden, müssen Neubauprojekte aus dem schrumpfenden Kernhaushalt bezahlt werden. Üblicherweise sei es genau umgekehrt, da künftige Generationen von Neubauten profitieren und daher eine Kreditfinanzierung gerechtfertigt sei.
Innerhalb der Regierungskoalition sollen die unterschiedlichen Darstellungen von Finanz- und Verkehrsministerium bereits zu Spannungen geführt haben. Obwohl Kritiker das Vorgehen für verfassungsrechtlich fragwürdig halten, wird eine erfolgreiche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht als unwahrscheinlich eingeschätzt. Grund dafür ist, dass die Regierung für das Sondervermögen das Grundgesetz geändert hat und es in der Opposition keine ausreichende Mehrheit für einen Normenkontrollantrag gibt.