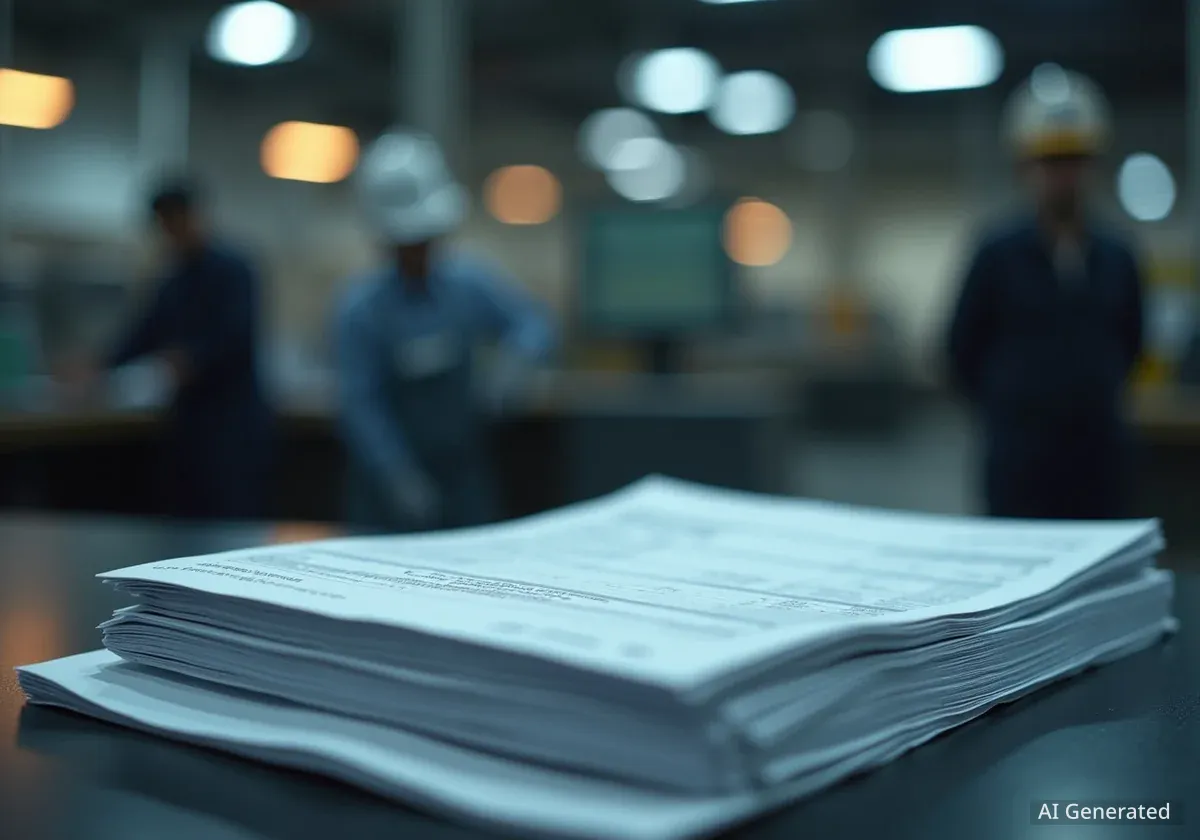Die deutsche Industrie steht vor erheblichen Herausforderungen. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, dass die Arbeitskosten im Jahr 2024 deutlich über dem internationalen Durchschnitt lagen. Diese Entwicklung setzt die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zunehmend unter Druck und schürt Sorgen vor einer schleichenden Deindustrialisierung.
Wichtige Erkenntnisse
- Die Arbeitskosten in der deutschen Industrie waren 2024 um 22 Prozent höher als im Durchschnitt von 27 Vergleichsländern.
- Im Vergleich zum Euro-Ausland betrug der Kostenunterschied 15 Prozent.
- Die hohe Produktivität deutscher Unternehmen reicht nicht mehr aus, um diesen Kostennachteil auszugleichen.
- Experten warnen vor einer schrittweisen Deindustrialisierung, falls keine politischen Reformen umgesetzt werden.
Ein teurer Standort im internationalen Vergleich
Die Zahlen der IW-Studie sind eindeutig: Deutschland ist ein Hochlohnland. Im Jahr 2024 zahlten Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe hierzulande 22 Prozent mehr für Arbeit als ihre Konkurrenten in 27 wichtigen Industriestaaten. Innerhalb der Eurozone ist der Abstand mit 15 Prozent ebenfalls signifikant.
Diese hohen Kosten machen die Produktion in Deutschland teuer. In dem internationalen Ranking der Arbeitskosten werden nur drei Länder als noch teurer eingestuft: Lettland, Estland und Kroatien. Für Unternehmen, die auf globalen Märkten agieren, wird dieser Kostennachteil zu einer immer größeren Belastung.
Die Studie analysiert die sogenannten Lohnstückkosten. Diese Kennzahl setzt die Arbeitskosten ins Verhältnis zur produzierten Menge. Vereinfacht gesagt, zeigen sie, wie viel Lohn für die Herstellung einer einzelnen Produkteinheit gezahlt werden muss. Ein hoher Wert bedeutet, dass die Produktion im Vergleich teuer ist.
Was sind Lohnstückkosten?
Die Lohnstückkosten sind ein wichtiger Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Sie berechnen sich, indem die Arbeitskosten pro Arbeitnehmer durch die Produktivität (Bruttowertschöpfung pro Arbeitnehmer) geteilt werden. Steigen die Löhne stärker als die Produktivität, erhöhen sich die Lohnstückkosten, was den Produktionsstandort verteuert.
Produktivität kann Kosten nicht mehr ausgleichen
Lange Zeit konnte die deutsche Industrie ihre hohen Arbeitskosten durch eine herausragende Produktivität rechtfertigen. Deutsche Unternehmen galten als hocheffizient und technologisch führend. Laut der IW-Studie gehört Deutschland bei der Produktivität immer noch zur Weltspitze und belegt unter den 27 untersuchten Ländern den siebten Platz.
Allerdings reicht dieser Vorteil nicht mehr aus, um die hohen Kosten vollständig zu kompensieren. Andere Länder holen auf oder sind bereits vorbeigezogen. Als Beispiel werden die USA genannt: Dort sind die Arbeitskosten niedriger, während die Produktivität gleichzeitig deutlich höher ist als in Deutschland. Dies verschafft amerikanischen Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil.
Zudem zeigt die Entwicklung seit 2018 ein besorgniserregendes Bild. Während die Lohnstückkosten in Deutschland mit einem Anstieg von 18 Prozent weniger stark gewachsen sind als im Ausland, hinkt die Wirtschaftsleistung hinterher. Die Bruttowertschöpfung stieg hierzulande nur um drei Prozent, während sie in den Vergleichsländern um sechs Prozent zunahm. Deutsche Firmen konnten also trotz ihrer Effizienz weniger Produkte verkaufen.
Wachstum im Vergleich
- Anstieg der Lohnstückkosten (seit 2018): Deutschland +18%
- Wachstum der Bruttowertschöpfung (seit 2018): Deutschland +3%, Vergleichsländer +6%
Strukturelle Probleme verschärfen die Lage
Die hohen Arbeitskosten sind nicht das einzige Problem. Mehrere Faktoren kommen zusammen und setzen die deutsche Wirtschaft unter Druck. Dazu gehört der wachsende Fachkräftemangel, der die Löhne weiter in die Höhe treibt. Unternehmen müssen mehr zahlen, um qualifiziertes Personal zu finden und zu halten.
Gleichzeitig belasten hohe Energiekosten, insbesondere die Strompreise, die Produktion. Besonders energieintensive Branchen wie die Chemie- oder Stahlindustrie leiden darunter. Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), warnt bereits vor den Konsequenzen.
„Energieintensive Unternehmen verlagern ihre Produktion und damit Arbeitsplätze schon jetzt verstärkt ins Ausland“, so Adrian.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist der zunehmende Wettbewerb aus China. Der technologische Vorsprung, auf den sich viele deutsche Firmen lange verlassen konnten, schwindet. Das IW stellt fest, dass viele Unternehmen diesen Vorsprung gegenüber der chinesischen Konkurrenz teilweise verloren haben. Dadurch können sie seltener hohe Preise am Weltmarkt durchsetzen, was den Druck durch die hohen Standortkosten weiter erhöht.
Experten fordern dringende Reformen
Angesichts dieser Entwicklungen fordern Wirtschaftsexperten ein entschlossenes Handeln der Politik. Christoph Schröder, Ökonom am Institut der deutschen Wirtschaft, sieht dringenden Handlungsbedarf, um eine weitere Schwächung des Standorts zu verhindern.
Er fordert die Bundesregierung auf, den Anstieg der Lohnnebenkosten zu bremsen. Diese machen einen großen Teil der gesamten Arbeitskosten aus und werden durch Sozialabgaben finanziert. Schröder betont die Notwendigkeit von strukturellen Anpassungen, um die Sozialsysteme zukunftsfest zu machen und die Unternehmen zu entlasten.
„Ohne eine Reform der Sozialsysteme rutscht der Standort Schritt für Schritt in die Deindustrialisierung“, warnt IW-Ökonom Christoph Schröder.
Die Rezession, in der sich die deutsche Industrie seit Mitte 2018 befindet, unterstreicht die Dringlichkeit dieser Forderungen. Ohne grundlegende Reformen zur Senkung der Standortkosten und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit droht Deutschland, seine Position als eine der führenden Industrienationen der Welt zu verlieren.